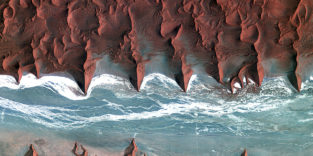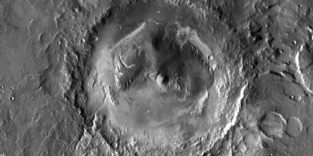Sternenstaub auf der Erde
Forscher der ETH Zürich fanden heraus, dass unsere Erde zum Teil aus Sternenstaub entstand. Dieser besondere Staub stammt von den sogenannten roten Riesensternen und kommt zudem auf dem Mars und auf diversen Asteroiden vor. Darüber hinaus können die Wissenschaftler sogar erklären, weshalb unsere Erde um einiges mehr aus Sternenstaub besteht als Asteroiden und Planeten, die weiter von der Sonne entfernt sind.

Sternenstaub von Roten Riesen.
Foto: panthermedia.net/derocz
Woher kommt der Sternenstaub?
Vor etwa 4,5 Milliarden von Jahren brach eine interstellare Molekülwolke zusammen. Im Zentrum dieser gigantischen Wolke entstand unsere Sonne. Um die Sonne herum bildete sich eine Scheibe, die aus Glas und aus Staub besteht. In dieser Scheibe entwickelte sich unsere Erde und alle anderen Planeten. In dem stark durchgemischtem, interstellaren Material aus der Molekülwolke befanden sich eine Menge exotischer Staubkörnchen. Professorin Maria Schönbächler von der ETH Zürich sagte dazu folgendes: „Dieser sogenannte Sternenstaub wurde um die anderen Sonnen herum gebildet“.
Die exotischen Staubkörnchen machten im Vergleich zu den restlichen Inhalten nur eine geringe Menge der gigantischen Staubmenge aus. Zudem wurde der Sternenstaub vollkommen ungleichmäßig innerhalb der Scheibe verteilt. Laut der Geochemikerin Maria Schönbächler war dieser Staub eine Art Salz oder Pfeffer. Jeder Planet erhielt bei seiner Entstehung seine ganz eigene Sternenstaub-Mischung. Sogar in der heutigen Zeit können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesen Sternenstaub, der bereits bei der Geburt unseres Sonnensystems vorhanden war, in Laboren mittels hochpräziser Messmethoden nachweisen. Die Wissenschaftler der ETH Zürich untersuchen dazu sorgfältig ausgewählte chemische Elemente und finden durch präzise Messungen heraus, wie hoch der Anteil verschiedener Isotope in den Elementen ist.
Isotope sind wie Fingerabdrücke
Isotope sind unterschiedliche Atomsorten von Elementen. Sie besitzen in ihrem Kern zwar die gleiche Anzahl an Protonen, verfügen jedoch über unterschiedlich viele Neutronen. Laut Maria Schönbächler von der ETH Zürich lässt sich die Verteilung der Isotope mit einem Fingerabdruck vergleichen. Darüber hinaus sagt die Wissenschaftlerin: „Sternenstaub hat besonders einzigartige und extreme Fingerabdrücke. Da er vollkommen ungleichmäßig verteilt wurde, bekam jeder einzelne Planet und sogar jeder Asteroid im Rahmen seiner Entstehung einen ganz individuellen Fingerabdruck“.
In der ETH Zürich wurden Meteoriten untersucht
Isotopische Anomalien konnten Wissenschaftler innerhalb der letzten 10 Jahre bereits mehrfach bei der Untersuchung von Meteoriten und Erdgestein in unzähligen Elementen nachweisen. Die Forschungsgruppe von Maria Schönbächler führte Untersuchungen an mehreren Meteoriten durch. Diese waren ursprünglich ein Teil der Kerne der Asteroiden und diese wurden vor langer Zeit zerstört. Bei den Untersuchungen konzentrierten sich die Wissenschaftler der ETH Zürich hauptsächlich auf das chemische Element Palladium. Davor hatten andere wissenschaftliche Teams die benachbarten chemischen Elemente, wie Ruthenium oder Molybdän untersucht. Aus den Voruntersuchungen ließ sich zwar eine Art von Voraussage für die danach folgenden Palladium-Resultate treffen, jedoch widersprachen die späteren Messungen deutlich dieser Prognose.
Mattias Ek, ein ehemaliger Doktorand an der ETH Zürich, sagte dazu folgendes: „Entgegen der Erwartung enthielten die untersuchten Meteoriten deutlich kleinere Palladium-Anomalien“. Mit einem neuen wissenschaftlichen Modell konnten die Wissenschaftler die neu gewonnenen Resultate erklären, dies gaben sie öffentlich in der bekannten Fachzeitschrift „Nature Astronomy“ bekannt. Aufgrund der besonderen Zusammensetzung entstand der Sternenstaub höchstwahrscheinlich in den roten Riesensternen. Diese alternde Sterne dehnen sich stark aus, denn der Brennstoff in ihrem Inneren ist erschöpft.
Erklärungen für die Rätsel um den Sternenstaub
Sogar unsere Sonne wird in 4 bis maximal 5 Milliarden Jahren zu einem solchen roten Riesenstern werden. Bei allen alternden Sternen finden langsame Neutroneneinfang-Prozesse statt und bei diesen entstehen schwere, chemische Elemente, wie Palladium oder Molybdän. Laut Mattias Ek ist das Palladium geringfügig flüchtiger als alle anderen gemessenen chemische Elemente. Aus diesem Grund kondensiert das Palladium etwas weniger zu Staub. Folglich war die Menge an Palladium im Sternenstaub in den von den Wissenschaftlern der ETH Zürich untersuchten Meteoriten etwas kleiner.
Sogar ein weiteres wichtiges Rätsel zum Thema Sternenstaub können die Wissenschaftler der ETH Zürich plausibel erklären: Auf unserer Erde gibt es vergleichsweise mehr Materialien von den roten Riesensternen als auf anderen Planeten oder Asteroiden, wie dem Mars oder der Vesta. Das Gleiche trifft auf alle Asteroiden und Planeten zu, die sich weiter draußen in unserem Sonnensystem befinden. Auf diesen Asteroiden und Planeten haben sich stattdessen mehr Materialien angereichert, die von den Supernova-Explosionen stammen.
Sternenstaub auf der Erde am größten
Maria Schönbächler von der ETH Zürich erklärt: „Als unsere Planeten entstanden, war deren Temperatur in der Nähe der Sonne vergleichsweise hoch“. Aus diesem Grund verdampften viele labile Staubkörner, die zum Beispiel einen Mantel aus Eis besaßen. Die interstellaren Materialien enthielten Sternenstaub, doch dieser wurde in der Nähe der Sonne zerstört. Im Gegensatz dazu war der Sternenstaub, der von den roten Riesensternen stammt, um einige stabiler und konnte sich anreichern. Selbst Staubkörner, die durch eine Supernova-Explosion entstehen, verdampfen höchstwahrscheinlich leichter und schneller, denn sie sind etwas kleiner. Aufgrund dieser Fakten können die Wissenschaftler der ETH Zürich erklären, weshalb der im Labor untersuchte Sternenstaub vorwiegend von den roten Riesensternen stammt und auf unserer Erde vergleichsweise am größten ist.
Lesen Sie auch:
Ein Beitrag von: