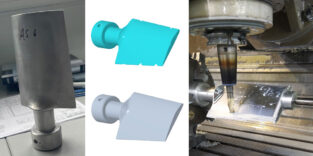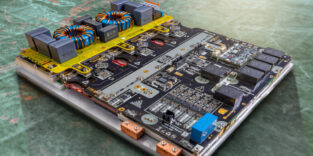Spinnenfaden für Schutzwesten
VDI nachrichten, München, 6. 10. 06, ber – Es kommt nicht oft vor, dass Innovationen auf verlorenem Wissen beruhen. Doch auf Naturfasern trifft das zumindest teilweise zu. Ergebnis ist etwa die Entwicklung eines Spinnapparats nach dem Vorbild der Gartenkreuzspinne, bei dem nun allerdings Bakterien zur Herstellung technischer Fasern eingespannt werden.
Jäger und Sammler nutzten einst eine Fülle von Fasern – von Muschelseiden bis hin zu Spinnenfäden. Daraus stellten sie Wundauflagen, Fangnetze und Seile her. Auch im alten Ägypten und im antiken Rom zählte man auf diese ausgefallenen Fasern.
„Es ist Zeit, dass wir uns auf das Wissen der Vorfahren besinnen und diese Materialien genauer erforschen“, fordert Thomas Scheibel, Biotechnologe im Fiberlab an der Technischen Universität München.
Alleine 37 000 Spinnenarten sind heute bekannt. Darunter produzieren sämtliche Arten der Radnetzspinne jeweils bis zu sieben verschiedene Seiden. Damit bieten die Tiere eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Fäden.
Die Industrie konnte den Achtbeinern dennoch lange nichts abgewinnen, da sich etwa Radnetzspinnen im Gegensatz zur chinesischen Seidenraupe nicht ohne Weiteres in Terrarien halten lassen. Einige gehen ein. Andere werden im Gehege zu Kannibalen und fressen ihre Artgenossen.
Doch mit der Biotechnologie lässt sich das Gewirr von Fäden und Fasern in der Natur aufdröseln. So durchforstete Scheibel das Genom der Gartenkreuzspinne Araneus diadematus nach den Bauplänen für deren Seide. Vor allem der Abseilfaden des Tieres ist extrem reißfest.
Scheibel entdeckte zwei Gene, welche je ein Eiweiß als Zutat für die Spinnenseide hervorbringen. Beide Eiweiße werden im Hinterleib der Spinne zusammengemischt und zum Faden versponnen. Dabei kann die Spinne die Eigenschaften des Fadens nach Bedarf variieren. Wird etwa weniger Wasser zugegeben, wird das Material fester. Der Hinterleib des Achtbeiners gleicht einem postmodernen Spinnapparat.
Fasziniert von den formidablen Fähigkeiten der Spinne hatten in der Vergangenheit schon viele Forscher versucht, es dem Tier gleichzutun. Sie pflanzten die Seidengene in Zellen aus Babyhamster, Ziege, Tabakpflanze oder Bakterien, um sie zur Faserfabrik umzurüsten. Doch alle Versuche waren vergebens.
„Ein Problem ist, dass die Spinnengene extrem groß sind. Die Erbinformation ist nicht ohne Weiteres von Mikroorganismen abzulesen“, legt Scheibel dar. Da Bakterien und Spinnen eine unterschiedliche genetische Sprache verwenden, mussten die Gene außerdem von Spinnen- in Bakterienvokabular übersetzt werden. Dafür musste Scheibels Team die Genfragmente künstlich nachbauen.
Erst nach diesen Mühen glückte der Transfer in E. coli-Bakterien: Die zurechtgestutzten Gene waren einerseits klein genug, um von den Mikroben effizient abgelesen werden zu können. Andererseits enthalten sie alle essenziellen Informationen, damit die beiden Eiweiße für den Abseilfaden entstehen.
In einem Spinnapparat können die Münchner seit Kurzem beide Substanzen wie im Hinterleib der Spinne zu einem Faden verarbeiten. „Das Produkt gleicht zu 95 % dem Vorbild aus der Natur“, betont Scheibel.
Die 5 % Abweichung rühren vom Zurechtschneiden der Gene. „Unser Industriepartner kann mit dem Verfahren theoretisch bereits einige Kilogramm Spinnenseide am Tag erzeugen. Für großtechnische Anwendungen werden aber einige Hundert Tonnen benötigt“, räumt der Erfinder ein. Der Preis für die Herstellung sei mit synthetischen Fasern vergleichbar. Der Markt für das naturidentische Produkt werde auf mehrere Hundert Millionen Dollar geschätzt.
Im Unterschied zu den Fähigkeiten der Spinne lassen sich aus dem Münchner Spinnapparat jedoch nicht nur Fäden, sondern auch Folien, Schäume, Gele und Kügelchen herstellen. Dazu muss zu den Eiweißen lediglich eine Chemikalie zugegeben werden und schon präsentiert sich das Material von selbst in neuer Form. Mit ausreichend Phosphat bilden sich beispielsweise Kügelchen. „Wir imitieren die Natur nicht nur, sondern können auch neue Produkte entwickeln“, sagt Scheibel.
Auch andere Forscher versuchen, über die Spinnenfäden zu neuen Werkstoffen zu gelangen. Bioingenieure an der Tufts University in Medford (Massachusetts) konnten Spinnenseide kürzlich mit Siliziumdioxid fusionieren.
„Wir machen chimärenartige Materialien, die die Bausteine aus zwei Naturstoffen vereinen: aus der reißfesten Spinnenseide und der bruchfesten Schale von Kieselalgen, dem Siliziumdioxid“, erklärt David Kaplan vom Zentrum für Bioingenieurwesen und Biotechnologie der Tufts University. Der neue Verbundwerkstoff könnte als Knochenimplantat eingesetzt werden.
2002 konnte Kaplan bereits eine Sensation verkünden. Ihm war es gelungen, einen Kreuzbandriss zu flicken, indem er eine neue Sehne auf einer Unterlage aus Seidenproteinen wachsen ließ. „Wir können uns jetzt sogar an ganz neue Spinnenseiden herantrauen, die die Natur selbst nie hervorgebracht hat“, freut sich Kaplan.
Allen Materialien aus Spinnenseide ist die enorme Stabilität gemeinsam, die auch den Abseilfaden kennzeichnet. Dieser lässt sich bis zum Dreifachen seiner Länge ausdehnen, ohne zu reißen. Der filigrane Faden ist sogar fester als Stahl. Im Unterschied zu vielen elastischen Garnen schnellt er auch nicht wie Gummi in seine ursprüngliche Position zurück.
„Spinnenseide ist einzigartig. Besonders interessant ist die Verwendung des Gewebes für kugelsichere Westen, Fallschirme und Air Bags“, umreißt Scheibel. Das gerade gegründete Unternehmen AMSilk bei München soll jetzt mögliche Einsatzgebiete ausloten. Wird der Faden etwa mit bestimmten Wirkstoffen getränkt, könnte dies die zum Beispiel die Wundheilung beschleunigen – wie bei den alten Römern. SUSANNE DONNER/ber
Ein Beitrag von: