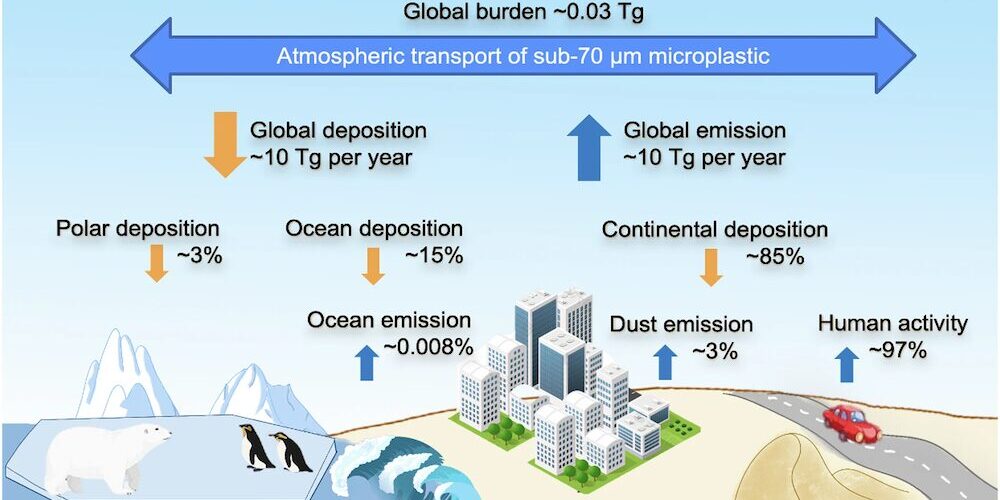Mikroplastik im Essen: Neue Analysemethoden entwickelt
Wie kann man Mikroplastik in Meerestieren erkennen und messen? Unklare Messergebnisse und fehlende Standards erschweren bislang die Bewertung. Neue Analyseverfahren könnten helfen, Zuverlässigkeit in die Forschung zu bringen.

Mit neuen Analysemethoden lässt sich Mikroplastik in Meerestieren zuverlässiger nachweisen.
Foto: Smarterpix/sarayut
Die Frage, wie viel Mikroplastik in Meerestieren steckt, beschäftigt Wissenschaft sowie Verbraucherinnen und Verbraucher gleichermaßen. Die Angaben zur Belastung schwanken erheblich, was vor allem auf fehlende standardisierte Verfahren in der Lebensmittelüberwachung zurückzuführen ist. Häufig gestaltet es sich schwierig, die Ergebnisse verschiedener Studien miteinander zu vergleichen, da sie auf unterschiedlichen Methoden beruhen. Dementsprechend schwierig ist es, diese zu bewerten. Forscherinnen und Forscher des Max Rubner-Instituts haben dieses Problem erkannt und bestehende Analysen aus der Umweltforschung so modifiziert, dass sie gezielt für die Untersuchung von Mikroplastik in Meerestieren angewendet werden können.
Um Mikroplastik in Meerestieren im essbaren Gewebe zu erfassen, kommt es zunächst darauf an, störende organische Bestandteile wie Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate zu beseitigen. „Das darf die winzigen Kunststoffpartikel nicht beschädigen“, betont Julia Süssmann, die das Forschungsvorhaben am Max Rubner-Institut leitet. Ihr Team entwickelte dazu ein spezielles Verfahren, bei dem das Gewebe zuerst sowohl enzymatisch als auch chemisch aufgelöst wird. Danach folgt eine Druckfiltration, die verbliebene Plastikpartikel von der restlichen Flüssigkeit abtrennt. Auf diese Weise ist es möglich, empfindliche Proben zu gewinnen, in denen selbst kleinste Kunststoffreste aufspürbar bleiben.
Präzise Methoden für Mikroplastik in Meerestieren
Bisherige Untersuchungen zeigen, dass Mikroplastik in Meerestieren größtenteils in sehr kleinen Mengen und zudem äußerst ungleichmäßig auftritt. „Darum brauchen wir besonders empfindliche Nachweismethoden“, erklärt Süssmann. Besonders hilfreich dafür sind sogenannte massebasierte Methoden: Hier wird die Probe unter Luftabschluss erhitzt, wodurch sich das organische Material zersetzt und gasförmige Produkte entstehen. Aus den Signalen dieser Gase lässt sich die Menge des vorhandenen Plastiks berechnen. Hinzu kommt, dass auf diese Art verschiedene Kunststoffsorten – darunter Polyethylen oder Polypropylen – erkannt und gezählt werden können.
Um zusätzlich die Erkennbarkeit zu verbessern, hat das Team des Max Rubner-Instituts ein Färbeverfahren entwickelt: Ein spezieller Fluoreszenzfarbstoff, zum Beispiel Nilrot, sorgt dafür, dass kleine, durchsichtige Plastikteilchen auffällig leuchten und so von gewöhnlichen Lichtmikroskopen erfasst werden. Gleichzeitig wird mithilfe eines zweiten Farbstoffs, der allein natürliches Gewebe einfärbt, störendes Hintergrundleuchten unterdrückt. Mithilfe einer halbautomatischen Bildauswertung lassen sich Menge, Größe und Form der Kunststoffteilchen differenziert bestimmen.
Mikroplastik: Herausforderungen bei der Analyse
Plastikpartikel kommen beinahe überall vor. Eine Tatsache, die Laborteams vor besondere Schwierigkeiten stellt. „Wir haben deshalb penibel darauf geachtet, nicht selbst Plastik in die Proben einzutragen“, stellt Süssmann klar. Trotz umfangreicher Vorsichtsmaßnahmen können Geräte, Handschuhe oder auch verwendete Chemikalien die Ergebnisse beeinflussen, da sie unerwünschte Plastikpartikel in die Untersuchung einbringen. Um diesem Problem vorzubeugen, hat das Team sogenannte Blindproben gemeinsam mit den eigentlichen Lebensmittelproben analysiert. So ließ sich abschätzen, inwieweit eine Verunreinigung durch die Laborumgebung Einfluss auf die Ergebnisse genommen haben könnte.
Die Forschenden widmeten sich zudem dem Nachweis noch kleinerer Kunststoffpartikel, dem sogenannten Nanoplastik. Allerdings zeigte sich, dass das Entfernen solcher winziger Teilchen aus dem Gewebe äußerst anspruchsvoll ist. Selbst nach intensiver chemischer Behandlung hafteten Nanoplastikreste häufig an den Filtern oder verklumpten. Organische Bestandteile wie Proteine und Fette störten den Nachweis zusätzlich, da sie die Analyse der Signale überdeckten. Ein gesicherter Nachweis von Nanoplastik in Fisch und Meeresfrüchten ist daher bislang nicht möglich.
Weitere Herausforderungen beim Nachweis von Mikroplastik
Die Analyse von Mikroplastik in Meerestieren bleibt aufgrund der zahlreichen Einflüsse und unklaren Datenlage komplex. „Mikroplastik ist kein Problem, das sich nur auf Fisch und Meeresfrüchte beschränkt“, sagt Süssmann. Ihre Untersuchungen weisen auf Plastikpartikel in unterschiedlichsten Lebensmitteln wie Milch, Eiern, Fleischprodukten oder Honig hin. Dennoch betont das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass auf Basis der aktuellen Kenntnisse gesundheitliche Risiken durch Mikroplastik in Lebensmitteln, insbesondere Mikroplastik in Meerestieren, als unwahrscheinlich gelten.
Obwohl sich Mikroplastik inzwischen in vielen Meerestieren nachweisen lässt, fehlt es weiterhin an gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen über mögliche gesundheitliche Risiken. Für eine abschließende Bewertung ist weitere Forschung zu Wirkung und Aufnahmewegen notwendig. Der Nachweis von Mikroplastik in Meerestieren hängt letztlich maßgeblich von der Sensitivität und Standardisierung der verwendeten Methoden ab, deren Entwicklung weiterhin im Fokus bleibt.
Ein Beitrag von: