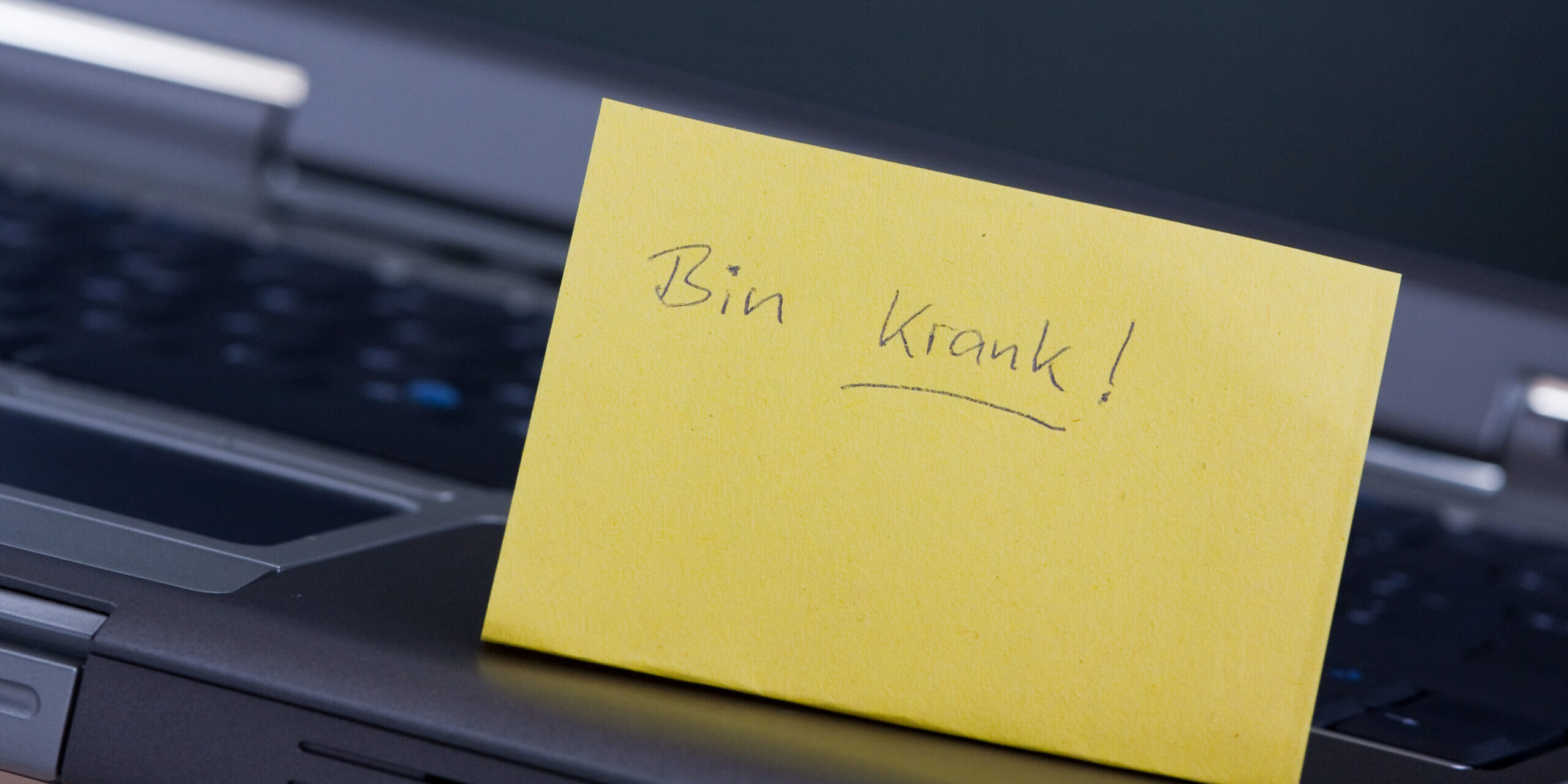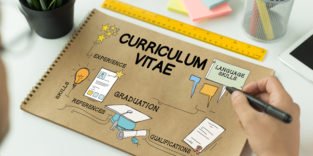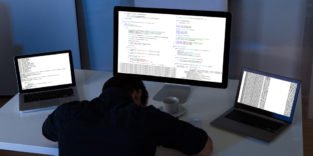Nach der Krankheit: Schritt für Schritt zurück in den Job mit BEM
Angesichts des Fachkräftemangels unverzichtbar: Nach Erkrankungen hilft das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM), in den Job zurückzufinden.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) unterstützt Beschäftigte nach längerer Krankheit beim strukturierten Wiedereinstieg ins Arbeitsleben – individuell, freiwillig und gesetzlich geregelt..
Foto: panthermedia.net/opolja
Von Null auf Hundert in nur 1,4 Sekunden – das kann der Supersportwagen McMurtry Spéirling angeblich: „Ein wahres Monster, das nur darauf wartet, losgelassen zu werden“, schreibt das Portal speedxperts.com über das Gefährt. Bei Menschen – nicht nur, aber auch bei den begehrten Fachkräften – sieht die Sache anders aus: Monster wollen sie nicht sein, losgelassen werden möchten sie auch nicht, und in kürzester Zeit „von null auf hundert“, also auf Höchstleistungsniveau bei der Arbeit zu kommen, ist ihnen nicht möglich – schon gar nicht nach längerer Krankheit. Das müssen sie auch nicht.
Damit Beschäftigte nach Erkrankungen Schritt für Schritt wieder ins Arbeitsleben einsteigen können, gibt es das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM). Ziel ist, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, künftige Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden und die Betreffenden im Unternehmen zu halten, sei es am alten Arbeitsplatz oder in einer neuen, den Umständen angepassten Tätigkeit.
Müssen Unternehmen Betriebliches Eingliederungsmanagement anbieten?
Unternehmen sind grundsätzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten ein BEM-Verfahren anzubieten, wenn diese innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate sechs Wochen oder länger arbeitsunfähig waren. Mit dem zwölfmonatigen Zeitraum ist kein Kalenderjahr gemeint, es geht tatsächlich um die unmittelbar zurückliegenden zwölf Monate. Der sechswöchige Zeitraum gilt sowohl für durchgängige Erkrankungen „am Stück“ als auch für die Summe kürzerer Erkrankungsphasen innerhalb der zwölf Monate. Bei Bedarf, darauf weist AOK-Bundesverband eGbR (AOK) auf seinem Fachportal für Arbeitgeber hin, kann BEM auch schon früher angeboten werden.
Müssen Beschäftigte am Betrieblichen Eingliederungsmanagement teilnehmen?
Nein, das müssen sie nicht. Die Teilnahme an BEM-Verfahren ist freiwillig. Aber sie ist generell empfehlenswert, und das aus zwei Gründen: Zum einen ist es je nach Erkrankung sehr gut möglich, in den Gesprächen Maßnahmen zu finden, auf die die Beschäftigten allein vielleicht nicht gekommen wären – zum Beispiel zusätzliche medizinische Behandlungsmöglichkeiten, konkrete Rehabilitationsmaßnahmen, eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder eine neue Definition der Arbeitsaufgaben im Detail. Zum anderen kann die Teilnahme am BEM in bestimmten Fällen dazu beitragen, krankheitsbedingte Kündigungen weniger wahrscheinlich zu machen. Beschäftigte können damit auch im Nachhinein zeigen, dass sie Interesse an ihrer Weiterbeschäftigung gehabt und sich engagiert haben.
Wie beginnt das BEM-Verfahren?
Noch einmal zurück auf „Null“. Voraussetzung für ein BEM ist die beschriebene anhaltende Erkrankung von Beschäftigten. Der erste Schritt muss dann vom Arbeitgeber kommen. Er ist verpflichtet, aktiv auf die oder den BEM-Berechtigten zuzugehen und ein BEM-Verfahren anzubieten. In einem ersten Gespräch wird über die Ziele, die Beteiligten und den weiteren möglichen Ablauf des Verfahrens informiert, zudem wird Datenschutz garantiert. „Lehnt die BEM-berechtigte Person ein BEM ab, so ist das BEM-Verfahren an dieser Stelle beendet“ – so klar formulieren es die Experten vom Projekt REHADAT, das vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. (IW Köln) geleitet und wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) unterstützt wird. Das REHADAT-Portal erklärt detailliert, wie es weitergehen kann, wenn die betreffenden Beschäftigten dem Verfahren zustimmen.
Wie läuft das BEM-Verfahren normalerweise ab?
Den einen, für alle gleichen Weg gibt es beim BEM nicht – es wäre auch nicht sinnvoll, da jede Erkrankung unterschiedliche Anforderungen mit sich bringt und jeder Mensch individuell mit einer Erkrankung umgeht. So kann es bei einer Verletzung infolge eines Unfalls vielleicht schon reichen, den Arbeitsplatz entsprechend technisch umzugestalten. Bei einer Tumorerkrankung kann es notwendig werden, neben der rein medizinischen Behandlung und einer möglichen Rehabilitation auch psychologische Unterstützung anzubieten. Trotz aller Besonderheiten läuft das BEM-Verfahren meist so ab: Nach Zustimmung des oder der Beschäftigten kommen als weitere Beteiligte neben dem Arbeitgeber unter anderem der Betriebsarzt, externe Experten, der Personal- oder Betriebsrat und bei schwerbehinderten Beschäftigten die Schwerbehindertenvertretung dazu. Gemeinsam werden mögliche Maßnahmen diskutiert, individuell zugeschnitten, umgesetzt, beobachtet, evaluiert und abschließend dokumentiert. Zwischenzeitlich sind weitere Gespräche möglich.
Die klassische stufenweise Eingliederung: das „Hamburger Modell“
Sie ist zwar nicht die einzige, aber die bei Weitem populärste Variante des betrieblichen Eingliederungsmanagements: die stufenweise Wiedereingliederung, auch als „Hamburger Modell“ bezeichnet. Die Idee: Man geht klar davon aus, dass die Betreffenden über einen längeren Zeitraum in Etappen wieder ihre volle berufliche Belastbarkeit an ihrem alten Arbeitsplatz erreichen. Zunächst erstellt der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin gemeinsam mit den Beschäftigten einen Stufenplan auf. In diesem Plan wird die ursprüngliche Arbeitszeit erst deutlich reduziert und dann stufenweise wieder erhöht. Wenn die Beschäftigten damit einverstanden sind, können auch der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin einbezogen werden. Ein Tipp vom Projekt REHADAT: Sämtliche Formulare zur Feststellung und Einleitung der Stufenweisen Wiedereingliederung bietet die Deutsche Rentenversicherung zum Download an.
Ist das BEM ein Wundermittel?
Wunder gibt es immer wieder – so lautet ein Klassiker der deutschen Schlagermusik (gesungen 1970 von Katja Ebstein). Das mag so sein und dann auch zu großer Freude führen, doch Wunder werden vom BEM gar nicht erwartet. Es geht vielmehr darum, individuell zugeschnittene Unterstützungsmaßnahmen für die betroffenen Beschäftigten zu finden, was in vielen Fällen gelingt, nicht zuletzt durch den persönlichen Kontakt der Beteiligten miteinander. Hinzu kommt: Weder den Beschäftigten noch den Unternehmen entsteht ein finanzieller Nachteil gegenüber der Situation der Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten, denn es werden weiterhin Kranken- oder Übergangsgeld, gegebenenfalls auch andere Leistungen wie das Verletztengeld, gezahlt. Und, Stichwort Fachkräftemangel, auch die Arbeitgebenden profitieren. Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) formuliert es auf ihrer Website so: „Zudem bleiben dem Unternehmen das Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Mitarbeiters erhalten“.
Die gesetzlichen Grundlagen
- Das BEM ist in § 167 Abs. 2 SGB IX verankert. SGB IX steht kurz für: Sozialgesetzbuch Neuntes Buch.
- Seit dem 1.5.2004 gilt das BEM gesetzlich vorgeschrieben.
- Die Regelungen des BEM gelten grundsätzlich für alle Mitarbeitenden, von Auszubildenden bis zu leitenden Beschäftigten. Sie gelten nur für Vollzeit- sondern auch für Teilzeit- oder befristet Beschäftigte.
Die häufigsten Krankheitsarten an Arbeitsunfähigkeitstagen
Die Ursachen dafür (Quelle: Statista 2025) , krankheitsbedingt der Arbeit fernzubleiben, sind vielfältig. Bei einem Blick in die Statistik zeigt sich, dass es große Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit gibt. So machen allein drei Krankheitsarten (die wiederum jeweils viele einzelne Krankheitsbilder umfassen) mehr als die Hälfte aller Erkrankungen aus:
- Atmungssystem 20,6 %
- Muskel-Skelett-System 18,5%
- Psychische Erkrankungen 16,1%
Ein Beitrag von: