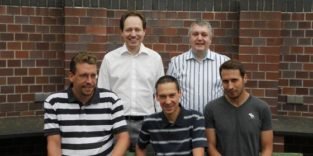Ein besonderes Wechselspiel sorgt für Ordnung in Metallen
Forscher der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung (MPIE) haben herausgefunden, dass einzelne Kohlenstoffatome energetische Vorlieben besitzen. Macht man sich diese geschickt zunutze, profitiert davon die Produktion dieser hochfesten Werkstoffe.
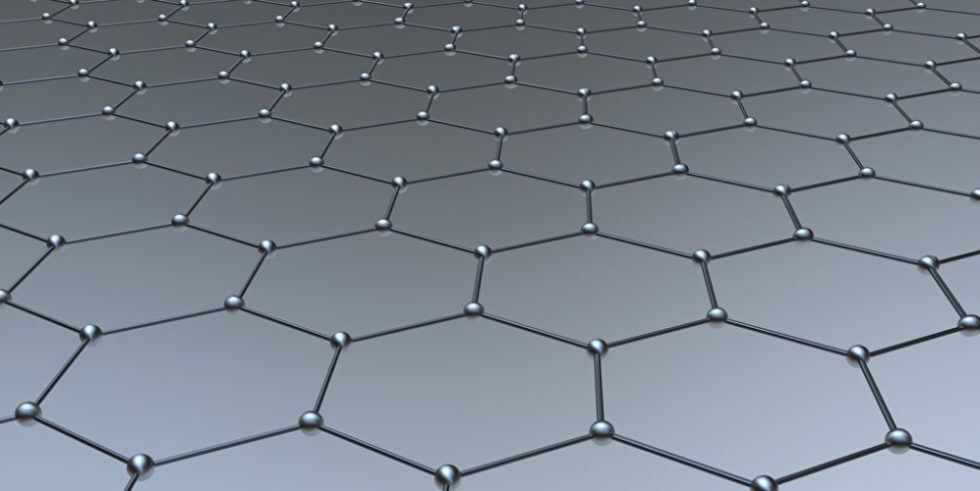
Die Verteilung der Kohlenstoffatome ist entscheidend für die Festigkeit von Stahl.
Foto: panthermedia.net/Nicholas Han
Stahl besteht aus Eisen und Kohlenstoff. Ob das Metall fest oder besonders fest ist, hängt aber nicht in erster Linie vom Mischungsverhältnis der beiden zentralen Bestandteile ab. Vielmehr ist die Verteilung der Kohlenstoffatome dafür entscheidend. Erst jetzt ist es einer Forschergruppe gelungen, das kollektive Verhalten der Atome vollständig zu verstehen – auch in Stählen, die schon seit Jahrzehnten im Einsatz sind.
Stahl spielt in nahezu jedem Bereich unseres Alltags eine große Rolle. Stahlbaukonstruktionen ermöglichen eine flexible, kostengünstige Bauweise – vor allem, wenn es darum geht, in die Höhe zu bauen. Bei Auto, Fahrrad und Zug kommt Stahl zum Einsatz, ebenso bei Brücken und Schienen. In der Industrie sind die großen Maschinen aus Stahl, im Handwerk die meisten Werkzeuge. Auch aus der Küche ist Stahl nicht mehr wegzudenken, werden die Klingen hochwertiger Messer doch aus diesem Material gefertigt. Er zählt zu den vielseitigsten Werkstoffen in der Konstruktion und kann nahezu unbegrenzt wiederverwertet werden. Verarbeiten kann man Stahl in Form von Gießen, Walzen, Schmieden, Fräsen und Schweißen. Hohe Festigkeit, gute Härtbarkeit, Steifheit und Bruchdehnung sind die entscheidenden Eigenschaften, die es bis heute kaum ermöglichen, Stahl durch einen anderen Werkstoff zu ersetzen. Wer einige Jahrzehnte zurückblickt, in die 1950er bis 1990er Jahre, sieht, dass Kohle und Stahl als Synonyme für den Aufschwung ganzer Regionen standen. Besonders das Ruhrgebiet war in dieser Zeit geprägt von der Montanindustrie.
Bei hoher Kohlenstoffkonzentration zeigen sich die Atome geordnet – ein Kollektiv entsteht
Die Kohlenstoffatome nehmen nach der Herstellung des Stahls eine ganz bestimmte Ordnung ein. Experten sprechen dann vom sogenannten Martensit. Es beschreibt das Härtungsgefüge, das hauptsächlich entsteht, wenn Stahl von seiner Härtetemperatur durch Abschrecken schnell heruntergekühlt wird. Forscher wussten bislang, dass die Kohlenstoffatome sich bis zu einer bestimmten Konzentration von Kohlenstoff an Grenzflächen und Defekten im Gitter der Eisenatome sammeln. Sobald die Konzentration einen bestimmten Wert übersteigt, konnte der Überschuss der Kohlenstoffatome allerdings, nicht wie vermutet, an solchen Defekten gefunden werden, obwohl genügend Platz vorhanden gewesen wäre. Stattdessen verteilen sich die Atome auf eine ganz bestimmte, sogar geordnete Weise im Kristallgitter. „Dabei ist der Abstand der Kohlenstoffatome im Gitter eigentlich viel zu groß, um eine solche Ordnung chemisch zu begründen,“ erklärt Jutta Rogal vom Interdisciplinary Centre for Advanced Materials Simulation Icams der RUB. Die Materialwissenschaft forscht daran, Werkstoffe im Design beeinflussen zu können, mit dem Ziel, durch bislang ungenutzte Eigenschaften neue Anwendungsfelder zu ermöglichen.
Die Hintergründe der Anordnung der Atome konnte die Forschergruppe nun durch eine Kombination von theoretischen Berechnungen und Experimenten herausfinden. „Ist die Kohlenstoffkonzentration zu gering für starke Verzerrungen, ist es energetisch am wenigsten aufwendig, Grenzen oder Defekte zu besetzen“, sagt Tilmann Hickel vom Max-Planck-Institut für Eisenforschung (MPIE). „Ab einer gewissen Konzentration stellt sich aber ein kollektiver Effekt der Atome ein, weil dieser Zustand mit einer Absenkung des chemischen Potenzials einhergeht – was den Gesetzen der Thermodynamik nach einer Energieminimierung entspricht.“
Das System als Ganzes zu betrachten führte zum Ergebnis
Für die Forscher war vor allem eine Erkenntnis entscheidend: Sofern man die Prozesse der Herstellung solcher Werkstoffe gezielt steuern will, muss man die Grundlagen in ihren komplexen Zusammenhängen kennen. „Wir müssen die Energie des gesamten Systems als Funktion von Druck und Temperatur im Auge haben, aber gleichzeitig auch die Energetik des einzelnen Teilchens in diesem System“, erläutert Jörg Neugebauer, Direktor des MPIE. Dieser Ansatz, das System als Ganzes zu betrachten, habe dazu geführt, dass die Wissenschaftler die theoretischen Vorhersagen mit in Experimenten gemessenen Daten in Einklang bringen konnten. Dafür griffen sie auf die Atomprobentomografie sowie die Transmissionselektronenmikroskopie zurück. Eine Förderung erhielt die Forschergruppe für ihr Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
Mehr zum Thema Werkstoffe:
Ein Beitrag von: