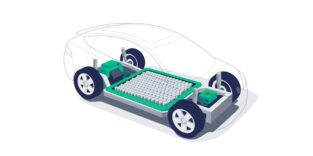Feststoffbatterien fürs E-Auto: So realistisch sind 1500 km pro Ladung
Feststoffbatterien im E-Auto: Wie sie funktionieren, welche Vorteile sie bringen – und wann Sie wirklich damit fahren können.

Feststoffbatterien versprechen kurze Ladezeiten und Reichweiten jenseits der 1000 Kilometer. Können sie das Versprechen halten?
Foto: Smarterpix / petovarga
Reichweite und Ladezeit zählen zu den häufigsten Kritikpunkten, wenn es um Elektroautos geht. Während sich Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) über Jahrzehnte bewährt haben, stoßen sie in diesen Bereichen an ihre Grenzen. Feststoffbatterien könnten genau dort ansetzen: Sie versprechen mehr Reichweite, schnelleres Laden und ein höheres Sicherheitsniveau.
Autohersteller weltweit investieren Milliardenbeträge in die Entwicklung der Technologie. Gleichzeitig arbeiten Forschungsinstitute an neuen Materialien, effizienteren Prozessen und praxisnahen Tests. Doch trotz der Euphorie gibt es Hürden: Noch fehlt der Beweis, dass sich die Festkörperbatterie in der Großserie wirklich durchsetzen kann.
Was steckt hinter der Technologie? Wie unterscheidet sie sich von konventionellen Lithium-Ionen-Akkus? Und wann können Sie ein Fahrzeug mit Feststoffbatterie wirklich kaufen? Der folgende Beitrag liefert einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Technik, zeigt Fortschritte, Probleme und Perspektiven auf.
Inhaltsverzeichnis
- Wie funktioniert eine Feststoffbatterie?
- Welche Materialien kommen zum Einsatz?
- Verschiedene Typen von Festkörperbatterien im Vergleich
- Vorteile gegenüber Lithium-Ionen-Akkus
- Was bremst die Entwicklung?
- Forschung und Praxis: Wer arbeitet an der Serienreife?
- Hersteller im Überblick – wer plant wann was?
- Neue Materialien und Durchbrüche in der Forschung
- Was bleibt Theorie, was wird bald Realität?
- Ausblick: Wann fahren Sie mit Feststoffakku?
- Zusammenfassung
Wie funktioniert eine Feststoffbatterie?
Im Kern unterscheidet sich eine Feststoffbatterie gar nicht so sehr von einem klassischen Lithium-Ionen-Akku: Auch hier wandern beim Entladen Lithium-Ionen von der Anode zur Kathode durch einen Elektrolyten, während sich die Elektronen außenherum auf den Weg machen und dabei Strom liefern.
Der große Unterschied liegt im Elektrolyt selbst: Statt einer brennbaren Flüssigkeit verwendet die Feststoffbatterie ein festes Material. Das kann ein Polymer sein, ein keramisches Pulver oder eine spezielle Glasschicht. In jedem Fall handelt es sich um eine Substanz, die Ionen leitet, aber elektrisch isolierend wirkt.
Diese Kombination bringt mehrere Vorteile mit sich: Der feste Elektrolyt lässt sich kaum entzünden – im Gegensatz zum flüssigen Pendant, das ähnliche Eigenschaften wie Benzin hat. Außerdem ermöglicht er den Einsatz neuartiger Anodenmaterialien, etwa aus reinem Lithium oder Silizium, die deutlich mehr Energie speichern als die heute üblichen Grafit-Anoden.
Das Ergebnis: Festkörperakkus könnten deutlich mehr Energie auf kleinerem Raum speichern – und damit größere Reichweiten ermöglichen, ohne das Fahrzeug schwerer zu machen.
Welche Materialien kommen zum Einsatz?
Der Elektrolyt ist das Herzstück jeder Feststoffbatterie. Von seiner chemischen Zusammensetzung hängt nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Leistungsfähigkeit ab. Aktuell gibt es drei große Gruppen:
- Polymerelektrolyte: Leicht zu verarbeiten, aber bei Raumtemperatur oft nicht leitfähig genug.
- Oxidische Festelektrolyte: Stabil und sicher, aber schwer herzustellen und mechanisch spröde.
- Sulfidbasierte Elektrolyte: Besonders leitfähig, aber empfindlich gegen Feuchtigkeit und nicht einfach zu verarbeiten.
Jingwen Jiang und Kolleg*innen von der TU München haben kürzlich eine neue Verbindung entwickelt, die Lithium-Ionen 30 % schneller transportiert als alle bislang bekannten Stoffe. Sie basiert auf Lithium, Antimon und Scandium. Das kristalline Material bietet hohe Leitfähigkeit bei gleichzeitig guter thermischer Stabilität. Laut Jiang sei es sogar für eine ganz neue Klasse von Ionenleitern geeignet.
Auch bei den Elektrodenmaterialien tut sich viel: Die Kombination aus einer Lithium-Metall-Anode und einer Nickel-Kobalt-Mangan-Kathode (NCM) gilt als besonders vielversprechend. Sie könnte die Energiedichte auf über 500 Wattstunden pro Kilogramm steigern – fast das Doppelte gegenüber modernen Lithium-Ionen-Zellen.
Verschiedene Typen von Festkörperbatterien im Vergleich
Nicht jede Feststoffbatterie ist gleich. Forschende unterscheiden zwischen unterschiedlichen Zellaufbauten – je nach verwendetem Material und technologischem Ansatz. Hier die wichtigsten Typen:
- Polymerbasierte Batterien: Diese Akkus setzen auf flexible Kunststoffe als Elektrolyten. Sie lassen sich leicht verarbeiten, müssen aber meist erhitzt werden, um leitfähig zu sein. Deshalb sind sie eher für spezielle Anwendungen oder warme Regionen geeignet.
- Oxidische Festkörperzellen: Sie bieten hohe Sicherheit und eine lange Lebensdauer. Ihre mechanische Stabilität ist hervorragend. Der Nachteil: Sie erfordern aufwendige Herstellungsverfahren und hohe Drücke bei der Verarbeitung.
- Sulfidische Zellen: Sie gelten als Favoriten vieler asiatischer Hersteller. Die ionische Leitfähigkeit ist hoch, doch die Verarbeitung ist heikel: Sulfide reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und können toxische Gase freisetzen, wenn sie beschädigt werden.
- Hybridzellen: Diese kombinieren feste und gelartige Komponenten – ein Kompromiss zwischen Sicherheit und einfacher Herstellung. Hybridmodelle gelten als Brückentechnologie auf dem Weg zur reinen Festkörperbatterie.
Alle Varianten bringen spezifische Vor- und Nachteile mit. Noch ist offen, welcher Typ sich am Ende durchsetzt. Viele Hersteller setzen daher auf Parallelentwicklungen.
Vorteile gegenüber Lithium-Ionen-Akkus
Die Liste möglicher Vorteile ist lang – und erklärt, warum die Festkörperbatterie als eine der zentralen Zukunftstechnologien im Bereich Elektromobilität gehandelt wird.
- Mehr Energie auf gleichem Raum: Ein klarer Pluspunkt ist die höhere Energiedichte. Hersteller sprechen von bis zu 500 oder sogar 600 Wattstunden pro Kilogramm. Zum Vergleich: Aktuelle Lithium-Ionen-Akkus erreichen im besten Fall etwa 250 bis 300 Wh/kg. Das bedeutet: Mit gleicher Akkugröße könnten E-Autos künftig fast doppelt so weit fahren. Manche Unternehmen – wie Gotion oder Xiaomi – geben Reichweiten von 1.000 bis 1.200 Kilometern an, teilweise sogar mehr.
- Kürzere Ladezeiten: Auch beim Laden verspricht die Feststofftechnologie Fortschritte. Während heutige Akkus an Schnellladesäulen oft 30 bis 60 Minuten benötigen, um auf 80 % zu kommen, sprechen einige Hersteller bei Festkörperzellen von unter 15 Minuten. BYD etwa nennt Ladezeiten von 12 Minuten für eine Reichweite von 1.500 Kilometern (CLTC-Zyklus) – allerdings unter Idealbedingungen und nicht auf europäische Normen umgerechnet.
- Höhere Sicherheit: Flüssige Elektrolyte sind leicht entzündlich. Bei mechanischer Beschädigung – etwa durch einen Unfall – kann das zu Bränden führen. Festkörperbatterien enthalten keine brennbaren Flüssigkeiten. Daher sinkt die Brandgefahr deutlich. Auch Kurzschlüsse durch Flüssigkeitsleckagen oder thermisches Durchgehen („thermal runaway“) lassen sich weitgehend vermeiden.
- Längere Lebensdauer: Viele Hersteller sprechen von deutlich verbesserten Ladezyklen. Volkswagen meldet bis zu 1.000 Ladezyklen mit nur 5 % Kapazitätsverlust. Das würde – je nach Reichweite – für 500.000 Kilometer oder mehr reichen. Ein klarer Vorteil für Vielfahrer*innen und den Einsatz im gewerblichen Bereich.
- Weniger kritische Materialien: Die Möglichkeit, auf alternative Anodenmaterialien wie Silizium oder Lithium-Metall zurückzugreifen, könnte langfristig helfen, den Bedarf an Kobalt und Nickel zu senken. Beide gelten als kritisch in der Lieferkette. Einige Hersteller experimentieren auch mit Natrium oder Magnesium als Alternativen zu Lithium.
Was bremst die Entwicklung?
Trotz aller Vorteile steckt die Feststoffbatterie noch nicht in Serienfahrzeugen – und das hat Gründe.
Problem #1: Volumenänderung der Anode
Ein zentrales Problem ist die sogenannte „Atembewegung“ von Lithium-Metall-Anoden. Diese dehnen sich beim Laden aus und schrumpfen beim Entladen wieder. Der Unterschied kann bis zu 10 % betragen. In einem festen Zellgehäuse oder Fahrzeugchassis kann das zu mechanischem Stress und Materialversagen führen. BMW und Solid Power testen daher Konzepte zur Drucksteuerung und Temperaturführung im Fahrzeug.
Problem #2: Produktionsumstellung
Die Herstellung von Feststoffzellen unterscheidet sich stark von klassischen Lithium-Ionen-Zellen. Rund 60 % der bestehenden Anlagen sind nicht weiterverwendbar. Neue Trocknungsprozesse, Schichtverfahren und Materialien erfordern massive Investitionen. Porsche Consulting spricht von bis zu einer Milliarde Euro für Pilotfabriken.
Problem #3: Materialverfügbarkeit
Einige neue Zelltypen benötigen mehr Lithium als herkömmliche Akkus – bis zu 100 % mehr, wie Studien zeigen. Gleichzeitig steigen die Preise und es gibt nur wenige Förderländer. Die Abhängigkeit von Rohstoffexporten etwa aus Chile, Australien oder China könnte zunehmen.
Problem #4: Lebensdauer und Dendritenbildung
Bei vielen Zellentwicklungen treten im Test Dendrite auf – feine Lithiumäste, die durch den Elektrolyten wachsen und Kurzschlüsse verursachen können. Japanische Forschende berichten von neuen Elektrodenkonzepten, die sich beim Laden kaum ausdehnen und damit dieses Problem umgehen sollen. Ob sich diese Konzepte in der Serie bewähren, bleibt offen.
Problem #5: Temperaturabhängigkeit
Nicht alle Feststoffzellen funktionieren zuverlässig bei Kälte. Einige benötigen Betriebstemperaturen über 60 °C, um effizient zu arbeiten. Hersteller wie Stellantis berichten zwar von Fortschritten – ihre Zellen sollen zwischen -30 °C und +45 °C einsatzfähig sein –, doch solche Leistungsdaten sind bisher nicht flächendeckend belegt.
Forschung und Praxis: Wer arbeitet an der Serienreife?
Das Rennen um die erste praxistaugliche Feststoffbatterie läuft auf Hochtouren. Nahezu jeder große Autohersteller verfolgt eigene Strategien, oft in Kooperation mit spezialisierten Batterieentwicklern.
- Mercedes und Stellantis mit Factorial: Mercedes testet seit Anfang 2025 gemeinsam mit dem US-Partner Factorial Energy eine Festkörperbatterie in einem leicht modifizierten EQS. Der Konzern sieht großes Potenzial in der sogenannten FEST-Technologie (Factorial Electrolyte System Technology), die auch Stellantis nutzt. Mercedes meldet eine Reichweite von über 1.000 Kilometern pro Ladung, die mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus bislang nicht erreicht wird. Stellantis hat im Juli 2025 verkündet, die ersten Festkörperzellen „in Automobilgröße“ erfolgreich validiert zu haben. 2026 soll eine Demonstrationsflotte starten – mutmaßlich bestehend aus elektrischen Dodge Charger Daytona. Die FEST-Zellen erreichen laut Konzern eine Energiedichte von 375 Wh/kg und sind bei Außentemperaturen von -30 bis +45 °C einsetzbar.
- BMW und Solid Power: BMW kooperiert seit Jahren mit Solid Power und testet aktuell All-Solid-State-Batterien (ASSB) in einem i7-Erprobungsfahrzeug. Dabei geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um Details wie Temperaturmanagement, Zellausdehnung und die Integration in bestehende Fahrzeugarchitektur. In Parsdorf bei München betreibt BMW eine eigene Prototypenlinie.
- Volkswagen mit QuantumScape: VW arbeitet eng mit QuantumScape zusammen – einem der bekanntesten Entwickler von Feststoffbatterien weltweit. Gemeinsam will man ab 2025 eine Pilotproduktion starten. Die Technologie basiert auf einem keramischen Festelektrolyten, der besonders temperaturstabil und sicher sein soll. QuantumScape meldete bereits 1.000 Ladezyklen bei nur 5 % Kapazitätsverlust. Auch die Ladezeit soll drastisch sinken.
- Toyota setzt auf Sulfid-Elektrolyte: Toyota verfolgt einen dreistufigen Entwicklungsplan für eigene Sulfid-Feststoffbatterien. Die Markteinführung ist ab 2027 geplant, zunächst in Premiummodellen der Marke Lexus. Gemeinsam mit Idemitsu Kosan entstehen derzeit Prototypen und Pilotanlagen in Japan.
- BYD mit eigenen Zellen: Der chinesische Konzern BYD entwickelt seit über zehn Jahren Feststoffakkus. Die ersten Straßentests laufen bereits im Modell „Seal“. Eine Massenproduktion ist für 2030 geplant. Der Hersteller spricht von Ladezeiten unter 15 Minuten und Reichweiten von bis zu 1.500 Kilometern. Ob diese Werte auch unter realen europäischen Bedingungen gelten, bleibt abzuwarten.
Hersteller im Überblick – wer plant wann was?
Ein kurzer Überblick, wann welche Hersteller mit der Serienfertigung rechnen:
| Hersteller | Partner | Serienstart geplant | Anmerkung |
| Mercedes | Factorial / ProLogium | vor 2030 | EQS mit Festkörperzelle im Test |
| BMW | Solid Power | ab 2028 | Tests im i7, eigene Prototypenlinie |
| Volkswagen | QuantumScape | Pilot ab 2025 | Serienproduktion ab 2030 |
| Toyota | Idemitsu Kosan | ab 2027 | Fokus auf Sulfidzellen |
| BYD | – | ab 2027 | „Seal“ mit Festkörperakku |
| Xiaomi | – | ab 2027 | 1.200 km Reichweite, 10 Min. Laden |
| Stellantis | Factorial | ab 2026 | „Demoflotte“ mit Charger Daytona |
| Huawei | – | offen | Reichweitenziel: 3.000 km |
Neue Materialien und Durchbrüche in der Forschung
Neben der Industrie arbeiten Universitäten und Labore weltweit an leistungsfähigen Materialien für Feststoffzellen. Besonders im Fokus:
- Elektrolyte mit Rekord-Leitfähigkeit: Ein Team der TU München entwickelte kürzlich ein Material aus Lithium, Antimon und Scandium, das Ionen 30 % schneller leitet als bisher bekannte Feststoff-Elektrolyte. Die Struktur ermöglicht eine hohe Ionenmobilität und thermische Stabilität – beides wichtige Voraussetzungen für den Dauereinsatz im Auto.
- Gotion mit 525 Wh/kg-Zelle: Das Unternehmen Gotion – ein Tochterunternehmen von VW – hat im Mai 2025 eine Festkörperzelle mit 525 Wh/kg vorgestellt. Diese zweite Generation der „Gemstone“-Batterie basiert auf einem verbesserten Sulfid-Elektrolyten. Erste Straßentests laufen bereits. Die Reduzierung des Stapeldrucks auf ein Zehntel früherer Werte gilt als Meilenstein für die Sicherheit.
- Xiaomi mit cell-to-body-Design: Xiaomi kombiniert eine neue Zellstruktur mit direkter Integration in die Fahrzeugkarosserie („cell-to-body“). Das spart Platz und ermöglicht laut Unternehmen eine Reichweite von 1.200 Kilometern – bei nur 12 cm Zellhöhe. Ob die Technologie auch bei Unfällen oder Reparaturen praktikabel ist, bleibt abzuwarten.
Was bleibt Theorie, was wird bald Realität?
Feststoffbatterien klingen in vielen Pressemitteilungen wie der unmittelbare Nachfolger klassischer Lithium-Ionen-Zellen. Doch zwischen Laborerfolg und Straßenalltag liegen oft Jahre.
Zwar melden viele Hersteller Fortschritte – etwa Reichweitenrekorde, Ladezeiten unter 15 Minuten oder hohe Energiedichten –, doch solche Zahlen stammen häufig aus internen Tests unter optimalen Bedingungen. Die Umrechnung auf reale Normzyklen wie WLTP oder EPA ergibt oft deutlich niedrigere Werte.
Auch die oft zitierte Schnellladefähigkeit wurde bislang selten unter Alltagsbedingungen bestätigt. Der von BYD genannte Wert von 1.500 Kilometern Reichweite nach zwölf Minuten Ladezeit etwa basiert auf dem chinesischen CLTC-Zyklus – dieser gilt als wenig realitätsnah und liegt meist 25 bis 30 % über europäischen Messwerten.
Ein weiteres Beispiel: Huawei meldete eine Reichweite von 3.000 Kilometern – ebenfalls laut CLTC. Expert*innen schätzen, dass dieser Wert sich in realen Bedingungen auf rund 1.300 Kilometer reduziert. Noch dazu ist bislang nicht klar, ob Huawei überhaupt die Produktionskapazität und das Know-how hat, diese Technik zu skalieren.
Was hingegen als realistisch gilt: Ab 2027 dürften erste Fahrzeuge mit Festkörperakkus in Serie gehen – zunächst in hochpreisigen Modellen wie Lexus, EQS oder i7. Massenmodelle könnten ab Anfang der 2030er folgen, sofern sich Kosten und Produktionsprozesse deutlich verbessern.
Ausblick: Wann fahren Sie mit Feststoffakku?
Die Technik entwickelt sich schnell – doch ein schneller Wechsel auf breiter Front ist nicht zu erwarten. Hersteller wie BMW oder Tesla setzen weiterhin auf verbesserte Lithium-Ionen-Technologien (etwa mit Rundzellen oder Natrium-Ionen) und betrachten Feststoffzellen eher als Ergänzung denn als Ersatz.
Einige Aussagen deuten sogar darauf hin, dass die Technik noch bis 2035 auf teure Fahrzeugsegmente beschränkt bleiben könnte. Entscheidend wird sein, wie schnell sich Lieferketten anpassen, Produktionskosten sinken und Sicherheitsprobleme wie Dendritenbildung gelöst werden.
Klar ist: Die Festkörperbatterie hat das Potenzial, Elektromobilität nachhaltiger, sicherer und alltagstauglicher zu machen. Doch die Übergangszeit wird von Parallelentwicklungen geprägt sein – mit verschiedenen Zellchemien, Designs und Anwendungen.
Bis Ihr eigenes E-Auto mit Feststoffakku vor der Tür steht, dürften also noch mindestens fünf bis sieben Jahre vergehen. Vielleicht auch mehr – oder weniger, wenn sich die Dynamik weiter beschleunigt.
Zusammenfassung
Feststoffbatterien gelten als vielversprechende Weiterentwicklung für Elektroautos. Statt flüssiger Elektrolyte nutzen sie feste Materialien, was Vorteile bei Sicherheit, Ladegeschwindigkeit und Energiedichte mit sich bringt. Zahlreiche Unternehmen weltweit arbeiten an Prototypen, Patenten und Pilotproduktionen. Die größten Herausforderungen betreffen noch die Lebensdauer, das Verhalten bei Kälte, die Produktionskosten und die Materialverfügbarkeit.
Aktuell testet eine Vielzahl von Herstellern wie Mercedes, BMW, Toyota, Stellantis und BYD ihre eigenen Technologien auf der Straße. Erste Serienanwendungen sind ab 2027 in hochpreisigen Fahrzeugen zu erwarten. Eine vollständige Ablösung der Lithium-Ionen-Technologie ist aber auf absehbare Zeit unwahrscheinlich. Vielmehr wird sich ein Nebeneinander unterschiedlicher Akkuformen etablieren – angepasst an Zielgruppe, Preis und Einsatzzweck.
Ein Beitrag von: