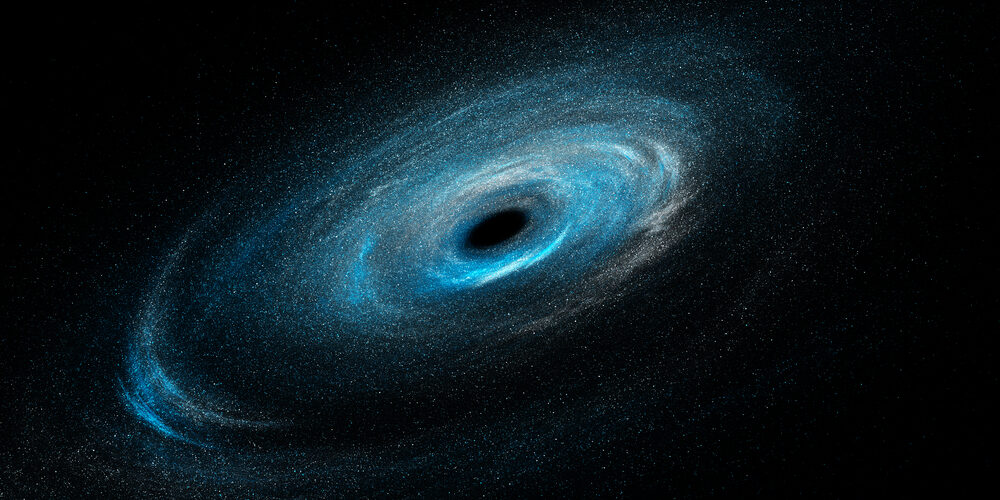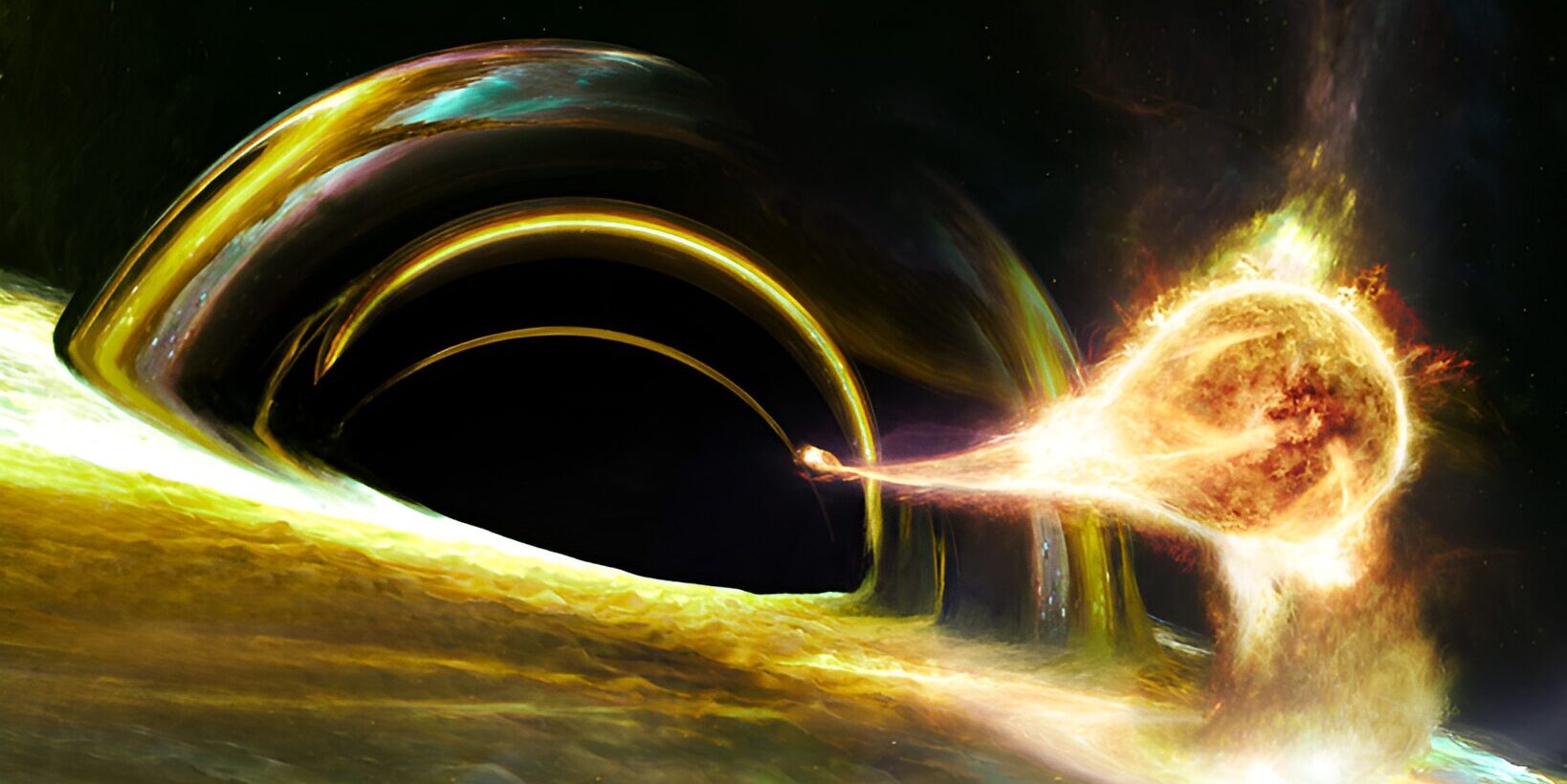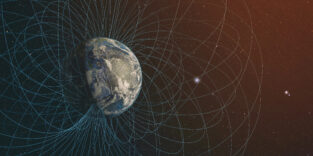Schwarze Löcher verstehen – geht das überhaupt?
Sie reizen die Grenzen der Physik aus: Schwarze Löcher verschlucken Licht und Zeit – was wir über sie wissen und wo die Rätsel beginnen.

Schwarze Löcher sind nach wie vor ein großes Rätsel der Physik - vieles ist noch nicht vollständig verstanden.
Foto: Smarterpix / saicle
Schwarze Löcher zählen zu den faszinierendsten Phänomenen der modernen Astrophysik. Sie verschlucken Licht, verzerren Raum und Zeit – und offenbaren zugleich die Grenzen unseres physikalischen Verständnisses. Forschende weltweit versuchen, ihre Eigenschaften besser zu verstehen. Dieser Beitrag erklärt, wie Schwarze Löcher entdeckt wurden, welche Rolle Albert Einsteins Theorien dabei spielen und wo die Grenzen unseres Wissens heute liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Die unsichtbaren Riesen des Alls
- Wie lassen sich Schwarze Löcher nachweisen?
- Blick auf den „Schatten“ eines Schwarzen Lochs
- Wie Einstein das Weltbild veränderte
- Schwarzschild entdeckt das Schwarze Loch in der Theorie
- Dunkle Sterne: Eine alte Idee lebt wieder auf
- Wann kollabiert ein Stern?
- Der Beweis durch Penrose
- Der erste Blick ins Unsichtbare: Cygnus X-1
- Die Kerr-Lösung: Wenn Schwarze Löcher rotieren
- Ist die Kerr-Lösung stabil?
- Was Gravitationswellen über Schwarze Löcher verraten
- Offene Fragen: Was passiert hinter dem Horizont?
- Wer versteht Schwarze Löcher?
Die unsichtbaren Riesen des Alls
Schwarze Löcher entziehen sich unserem direkten Blick. Kein Licht kann aus ihnen entweichen, nichts kehrt aus ihrem Inneren zurück. Dennoch sind sich Astronom*innen sicher, dass sie existieren. Denn obwohl Schwarze Löcher nicht sichtbar sind, hinterlassen sie Spuren. Und diese Spuren lassen sich mit modernen Instrumenten erkennen.
Schwarze Löcher entstehen, wenn sehr große Massen auf sehr kleinem Raum zusammenfallen. Die Schwerkraft ist dann so stark, dass sie selbst Licht festhält. Die Grenze, ab der kein Entkommen mehr möglich ist, nennt sich „Ereignishorizont“. Alles, was diese Schwelle überschreitet, ist für immer verloren – jedenfalls nach unserem heutigen Verständnis von Raum und Zeit.
Doch wie lässt sich so ein Objekt entdecken, wenn es unsichtbar ist? Die Antwort: durch seine Wirkung auf die Umgebung.
Wie lassen sich Schwarze Löcher nachweisen?
Im Zentrum unserer Milchstraße bewegen sich Sterne auf elliptischen Bahnen – aber um was kreisen sie? Dort befindet sich kein sichtbares Objekt. Dennoch lassen sich aus den Bahnen der Sterne Rückschlüsse auf eine unsichtbare, extrem massereiche Struktur ziehen. Die einzige Erklärung: Ein supermassereiches Schwarzes Loch.
Auch wenn Materie auf ein Schwarzes Loch zufällt, macht sich dieses bemerkbar. Durch die Rotation des Schwarzen Lochs kann Materie nicht direkt hineinfallen. Stattdessen bildet sie eine sogenannte Akkretionsscheibe. In dieser Scheibe reiben sich Gas- und Staubteilchen aneinander. Diese Reibung erzeugt enorme Hitze – und Strahlung in vielen Wellenlängen. Diese Strahlung ist messbar und verrät: Hier ist ein Schwarzes Loch am Werk.
Kommt ein Stern einem Schwarzen Loch zu nahe, wird er durch die extreme Gravitation auseinandergerissen. Auch dieses Ereignis sendet Strahlung aus – vor allem im Röntgenbereich. Manche Schwarzen Löcher wirken außerdem wie eine Linse. Sie krümmen den Raum so stark, dass Lichtstrahlen aus der Umgebung abgelenkt werden. Man spricht von einer Gravitationslinse. Beobachtete Lichtverzerrungen liefern Hinweise auf diese Objekte.
Blick auf den „Schatten“ eines Schwarzen Lochs
Schwarze Löcher selbst sind nicht sichtbar – aber ihre Umgebung schon. Im Jahr 2019 gelang einem weltweiten Verbund von Radioteleskopen erstmals ein Bild des „Schattenbereichs“ eines Schwarzen Lochs. Dieser Schatten ist keine feste Oberfläche, sondern eine dunkle Zone, in der Strahlung verschluckt wird.
Die Daten stammen von Antennen, die elektromagnetische Wellen im Radiobereich auffangen. Aus diesen Signalen wurden Bilder berechnet, die zeigen, was sich knapp außerhalb des Ereignishorizonts abspielt. Es handelt sich also nicht um ein Foto im klassischen Sinn. Dennoch zeigen die Aufnahmen: Schwarze Löcher sind reale Objekte – und sie sind messbar.
Wie Einstein das Weltbild veränderte
Anfang des 20. Jahrhunderts stand die Physik an einem Wendepunkt. Die klassische Mechanik, wie sie Newton formuliert hatte, erklärte zwar viele Phänomene im Alltag, doch bei hohen Geschwindigkeiten und starken Gravitationsfeldern stieß sie an ihre Grenzen. Insbesondere ließ sich nicht erklären, wie sich Licht unter dem Einfluss von Gravitation verhält.
Albert Einstein veröffentlichte 1915 seine Allgemeine Relativitätstheorie. Sie verknüpft Raum und Zeit zu einem einzigen Gefüge: der Raumzeit. Und sie beschreibt Gravitation nicht mehr als Kraft im klassischen Sinn, sondern als Krümmung dieser Raumzeit durch Masse und Energie. Ein großer Körper – wie ein Stern – krümmt also die Raumzeit in seiner Umgebung. Andere Objekte bewegen sich in dieser Krümmung, vergleichbar mit Kugeln, die über eine gespannte Gummimatte rollen.
Diese Idee hatte weitreichende Folgen. Zum Beispiel konnte Einstein damit ein Phänomen erklären, das in der klassischen Physik ein ungelöstes Rätsel war: die langsame Drehung der Umlaufbahn des Planeten Merkur. Seine sogenannte Periheldrehung ließ sich erst mit Einsteins Theorie korrekt berechnen. Die Beobachtungen passten nun zur Rechnung.
Schwarzschild entdeckt das Schwarze Loch in der Theorie
Nur kurze Zeit nach Veröffentlichung der Allgemeinen Relativitätstheorie lieferte der Astronom Karl Schwarzschild eine exakte Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen. Er berechnete, wie ein ruhender, kugelförmiger Massenkörper die Raumzeit krümmt. Grundlage seiner Rechnung war ein stark vereinfachtes Modell: ein massereiches Objekt, das sich nicht dreht und keine elektrische Ladung trägt.
Was Schwarzschild fand, war mathematisch korrekt, aber physikalisch kaum vorstellbar: Wenn ein Objekt eine bestimmte Kompaktheit erreicht, kann selbst Licht seiner Anziehung nicht mehr entkommen. Er identifizierte in seinen Gleichungen eine Grenze – heute kennen wir sie als Ereignishorizont. Dahinter ist keine Kommunikation mit der Außenwelt mehr möglich.
Die physikalische Interpretation dieser Lösung als Schwarzes Loch setzte sich allerdings erst viele Jahrzehnte später durch.
Dunkle Sterne: Eine alte Idee lebt wieder auf
Die Idee von Objekten, die Licht verschlucken, ist älter als Einstein. Schon Ende des 18. Jahrhunderts vermuteten die Naturwissenschaftler John Michell und Pierre-Simon Laplace, dass sehr massereiche Sterne eine so starke Anziehungskraft besitzen könnten, dass selbst Licht nicht entkommt. Sie nannten diese hypothetischen Objekte „dunkle Sterne“.
Doch ihre Überlegungen basierten noch auf Newtons Theorie. Erst mit Einsteins Modell wurde klar, dass es sich nicht um eine exotische Kraft handelt, sondern um die Wirkung von gekrümmtem Raum. Erst jetzt konnte man verstehen, wie so ein Objekt entstehen und was es für die Raumzeit bedeuten würde.
Wann kollabiert ein Stern?
Ein Stern bleibt stabil, solange er genug Brennstoff besitzt, um Energie zu erzeugen. Diese Energie strahlt er nach außen ab und gleicht damit die nach innen gerichtete Gravitationskraft aus. Doch irgendwann geht dieser Brennstoff zur Neige. Was dann geschieht, hängt von der Masse des Sterns ab.
Sterne mit geringer Masse, wie unsere Sonne, enden als Weiße Zwerge. Sie schrumpfen, aber ihre Restmasse hält sie im Gleichgewicht. Deutlich schwerere Sterne können jedoch unter ihrer eigenen Schwerkraft kollabieren.
Der Physiker Subrahmanyan Chandrasekhar berechnete in den 1930er-Jahren, dass es eine kritische Masse gibt – etwa 1,4 Sonnenmassen. Überschreitet ein Stern diese Grenze, kann er nicht als Weißer Zwerg bestehen. Dann wird er zu einem Neutronenstern oder – bei noch höherer Masse – zu einem Schwarzen Loch. Die genaue Grenze zwischen Neutronensternen und Schwarzen Löchern ist bis heute nicht exakt bekannt.
Der Beweis durch Penrose
Die frühen Modelle zur Sternentwicklung beruhten auf starken Vereinfachungen. Es blieb unklar, ob Schwarze Löcher auch unter realistischen Bedingungen entstehen. Der britische Physiker Roger Penrose zeigte in den 1960er-Jahren, dass ein gravitativer Kollaps ganz ohne idealisierte Annahmen ablaufen kann – eine wichtige Bestätigung für die Theorie.
Penrose nutzte ausgeklügelte mathematische Methoden, um zu zeigen, dass der Zusammenbruch massereicher Sterne fast zwangsläufig zur Bildung eines Schwarzen Lochs führt. Für diesen Nachweis erhielt er 2020 gemeinsam mit Andrea Ghez und Reinhard Genzel den Nobelpreis für Physik.
Der erste Blick ins Unsichtbare: Cygnus X-1
Die Theorie hatte ihre Grundlagen – aber wann tauchte das erste Schwarze Loch tatsächlich in Beobachtungsdaten auf?
Anfang der 1970er-Jahre entdeckten die Astronom*innen Tom Bolton, Louise Webster und Paul Murdin eine auffällige Röntgenquelle mit dem Namen Cygnus X-1. Sie befand sich in einem Doppelsternsystem, in dem ein sichtbarer Stern um ein unsichtbares, aber extrem massereiches Objekt kreiste. Die Bewegungen des sichtbaren Sterns ließen sich nur durch einen unsichtbaren Partner erklären – mit etwa der 15-fachen Sonnenmasse. Cygnus X-1 gilt heute als das erste überzeugend nachgewiesene stellare Schwarze Loch.
Mittlerweile geht die Forschung davon aus, dass allein in unserer Milchstraße mehrere Hundert Millionen solcher Objekte existieren – Überbleibsel von Sternen, die unter ihrer eigenen Schwerkraft kollabierten.
Neben diesen sogenannten stellaren Schwarzen Löchern gibt es auch supermassereiche Varianten mit Millionen oder gar Milliarden Sonnenmassen. Wie genau sie entstehen, ist nach wie vor unklar. Sicher ist nur: Im Zentrum fast aller Galaxien, auch unserer Milchstraße, sitzt ein solches Schwarzes Loch.
Die Kerr-Lösung: Wenn Schwarze Löcher rotieren
Die Schwarzschild-Lösung beschreibt ein ideales Schwarzes Loch ohne Rotation. Doch in der Realität rotieren Sterne – und damit auch ihre Überreste. In den 1960er-Jahren fand der neuseeländische Mathematiker Roy Kerr eine exakte Lösung der Einsteinschen Gleichungen für rotierende Schwarze Löcher. Diese sogenannte Kerr-Lösung beschreibt ein stationäres, aber rotierendes Schwarzes Loch mit zwei Parametern: Masse und Drehimpuls.
Diese Lösung enthält eine Besonderheit: Eine sogenannte Ergoregion außerhalb des Ereignishorizonts, in der keine Teilchen still stehen können – sie werden von der Raumzeit mitgerissen. In dieser Zone könnte theoretisch Energie aus einem Schwarzen Loch entnommen werden, ein Konzept, das später in den sogenannten Penrose-Prozess eingeflossen ist.
Auch für Teilchenbewegungen bietet die Kerr-Lösung interessante Eigenschaften. Der Physiker Brandon Carter entdeckte eine neue Erhaltungsgröße, die sogenannte Carter-Konstante. Sie ermöglicht es, die Bahnen von Teilchen rund um ein rotierendes Schwarzes Loch mathematisch genau zu beschreiben – trotz der komplizierten Geometrie.
Ist die Kerr-Lösung stabil?
Eine zentrale Frage der Forschung lautet: Wie stabil sind Schwarze Löcher? Oder anders gesagt: Wenn ein Schwarzes Loch in der Realität entsteht – etwa nach dem Zusammenbruch eines Sterns – verhält es sich dann wirklich so wie in den theoretischen Modellen?
Im Fall der Schwarzschild-Lösung gibt es bereits seit 1939 eine Beschreibung, wie ein solcher Kollaps ablaufen kann. J. Robert Oppenheimer und Hartland Snyder zeigten, dass eine dichte Staubwolke unter ihrer eigenen Schwerkraft kollabieren und dabei ein Schwarzes Loch bilden kann.
Für rotierende Schwarze Löcher – also für die Kerr-Lösung – gibt es keine solch einfache, exakte Lösung. Doch mithilfe numerischer Simulationen lässt sich der Prozess heute realitätsnah nachvollziehen. Dabei zeigt sich: In vielen Szenarien, etwa bei der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher oder beim Einfall großer Mengen Materie, bleibt die Struktur der Kerr-Lösung erhalten. Das spricht für ihre Stabilität – auch wenn ein vollständiger mathematischer Beweis noch aussteht.
Was Gravitationswellen über Schwarze Löcher verraten
Seit 2015 können Forschende Gravitationswellen direkt messen – schwache Erschütterungen der Raumzeit, ausgelöst durch massive kosmische Ereignisse. Der erste nachgewiesene Fall: die Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher. Die Signale, die dabei aufgezeichnet wurden, stimmen erstaunlich genau mit den Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie überein – inklusive der erwarteten Kerr-Struktur des Endprodukts.
Die Analyse solcher Wellen erlaubt Rückschlüsse auf Masse, Drehimpuls und sogar Form der beteiligten Schwarzen Löcher. Damit wird nicht nur Einsteins Theorie geprüft, sondern auch das Verhalten Schwarzer Löcher unter extremen Bedingungen besser verstanden.
Offene Fragen: Was passiert hinter dem Horizont?
Trotz aller Fortschritte bleibt das Innere eines Schwarzen Lochs ein Rätsel. Laut Einsteins Theorie nimmt dort die Raumzeitkrümmung unendlich zu – eine sogenannte Singularität. Was dort physikalisch geschieht, weiß niemand. Denn weder Beobachtungen noch bekannte Theorien liefern Antworten.
Hier stößt die Allgemeine Relativitätstheorie an ihre Grenzen. Um die extremen Bedingungen im Inneren eines Schwarzen Lochs zu beschreiben, braucht es eine neue Theorie, die Gravitation und Quantenmechanik verbindet. Eine solche Theorie – häufig als Quantengravitation bezeichnet – gibt es bisher nur als Konzept, nicht als vollständig bewiesenes Modell.
Forschende hoffen, dass künftige Beobachtungen, etwa durch das geplante Gravitationswellen-Observatorium „LISA“, neue Hinweise liefern. Auch Experimente mit extrem kalten Atomgasen oder in Teilchenbeschleunigern könnten irgendwann helfen, die Lücke zwischen Quantenphysik und Gravitation zu schließen.
Wer versteht Schwarze Löcher?
Schwarze Löcher zeigen eindrucksvoll, wie weit unser physikalisches Verständnis reicht – und wo es endet. Dank jahrzehntelanger Forschung können wir heute viele ihrer Eigenschaften erklären. Wir wissen, wie sie entstehen, wie sie Materie beeinflussen und wie sich ihre Existenz nachweisen lässt – obwohl sie selbst unsichtbar bleiben.
Doch es gibt auch Grenzen. Was genau in ihrem Innersten geschieht, bleibt Spekulation. Auch die Frage, ob sich ihre Rotationen wirklich in allen Fällen stabil verhalten, ist noch nicht abschließend beantwortet.
Ein vollständiges Verständnis Schwarzer Löcher – das verlangt eine Theorie, die wir noch nicht besitzen. Die Forschung geht weiter. Und sie bleibt spannend.
Quellen:
- Einstein, A. (1915): Die Feldgleichungen der Gravitation, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften.
- Schwarzschild, K. (1916): Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes, Sitzungsberichte der KPAW.
- Wald, R. M. (1984): General Relativity, University of Chicago Press.
- Michell, J. (1784): Philosophical Transactions of the Royal Society.
- Laplace, P. S. (1796): Exposition du système du monde.
- Chandrasekhar, S. (1931): The Maximum Mass of Ideal White Dwarfs, Astrophysical Journal, 74.
- Penrose, R. (1965): Gravitational Collapse and Space-Time Singularities, Phys. Rev. Lett., 14(3), 57–59.
Nobelpreis für Physik 2020 - Bolton, C. T. et al. (1972): Nature, 235: Beobachtung von Cygnus X-1.
- Kerr, R. P. (1963): Gravitational field of a spinning mass, Phys. Rev. Lett., 11, 237.
- Carter, B. (1968): Global Structure of the Kerr Family, Physical Review, 174(5), 1559.
- Oppenheimer, J. R. & Snyder, H. (1939): On Continued Gravitational Contraction, Phys. Rev., 56, 455.
- Abbott, B. P. et al. (LIGO & Virgo, 2016): Observation of Gravitational Waves, Phys. Rev. Lett., 116, 061102.
LIGO Scientific Collaboration - Event Horizon Telescope Collaboration (2019): First M87 Event Horizon Telescope Results, ApJ Letters, 875.
eventhorizontelescope.org - Rovelli, C. (2004): Quantum Gravity, Cambridge University Press.
- Kiefer, C. (2012): Quantum Gravity, Oxford University Press (2. Auflage).
- Thorne, K. S. (1994): Black Holes and Time Warps, W. W. Norton & Company.
- Carroll, S. M. (2004): Spacetime and Geometry, Addison-Wesley.
Ein Beitrag von: