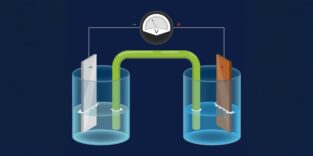Ammoniak aus der Kugelmühle als Alternative zu Haber-Bosch
Grüner Ammoniak aus Kugelmühlen? Forschende entwickeln nachhaltige Alternative zur energieintensiven Düngerproduktion.

Ammoniak wird in großen Mengen zum Düngen verwendet. Nun haben Forschende eine klimafreundliche Alternative für die Herstellung entwickelt im Vergleich zum Haber-Bosch-Verfahren.
Foto: Smarterpix / fotokostic
Mehr als 100 Jahre lang war die Menschheit auf das Haber-Bosch-Verfahren angewiesen, wenn Ammoniak produziert werden sollte. Jetzt bekommt die Technik, die gewaltige Mengen an Energie verbraucht und für zwei Prozent der weltweiten Emissionen an Kohlenstoffdioxid verantwortlich ist, gleich mehrfach Konkurrenz, die die Umwelt schont beziehungsweise gar nicht belastet.
Forschende der University at Buffalo und der University of Sydney lassen sie Fusionsarbeit von Stickstoff und Wasserstoff von künstlichen Blitzen erledigen, während Kollegen des Ulsan National Institute of Science and Technology (Unist) auf eine Technik setzen, die entwickelt worden ist, Materialien zu extrem feinen Pulver zu vermahlen, auf so genannte Kugelmühlen.
Was sind Kugelmühlen?
Das sind stählerne Behälter, die stählerne Kugeln beherbergen. Wenn der Behälter schnell rotiert kollidieren die Kugeln miteinander und zerschlagen das, was sich an den Kontaktstellen befindet. Forscher des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr haben schon vor vier Jahren mit dieser Technik aus Wasserstoff und Stickstoff Ammoniak hergestellt, das die Summenformel NH3 hat.
Mechanokatalyse nannte der Chemiker Steffen Reichle die Technik, bei der Atome der beiden Gase durch rohe Kräfte, die zwischen zwei aufeinanderprallende Stahlkugeln auftreten, miteinander verbunden werden. Schützenhilfe leistete ein eisenbasierter Katalysator, dem Reichle „chemischen Feenstaub“ hinzufügte, der tatsächlich zauberhafte Ergebnisse zur Folge hatte. Die Ausbeute an Ammoniak verdoppelte sich nahezu.
Was zauberhaft klingt, erfüllte jedoch bei weitem nicht das entscheidendste Kriterium: die -Wirtschaftlichkeit. Es reichte gerade mal, einen dünnen kontinuierlichen Ammoniakstrom nachzuweisen. Bei einem Weltbedarf von 150 Millionen Jahrestonnen war das nicht einmal der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.
Südkoreanische Forschende verbessern das Verfahren
Jong-Beom Baek, Unist-Professor für Chemie und Energie, hat mit seinem Team die Ausbeute drastisch verbessert. Das südkoreanische Forschungsteam setzt ebenfalls auf einen eisenbasierten Katalysator. Als „Feenstaub“ wählten sie jedoch Siliziumnitrid, das die katalytische Wirkung drastisch verbessert. Die Ausbeute stieg auf Anhieb um das 5,6-Fache.
Siliziumnitrid ist bekannt für seine außergewöhnliche Härte, die ihm Beständigkeit gegen Stöße, chemische Korrosion und Hitze verleiht, wodurch eine langfristige Unterstützung des Eisenkatalysators möglich ist. Baek und sein Team stellten den Kat-Beschleuniger aus ausgedienten Solarzellen her, was die Umweltverträglichkeit noch einmal verbessert.
Umweltbelastung sinkt nahezu auf Null
Wenn die Kugelmühle mit grünem Strom angetrieben wird und dieser auch genutzt wird, um den in der Mühlen benötigten Druck aufzubauen – der weitaus niedriger ist als der beim Haber-Bosch-Verfahren –, sinkt die Umwelt- und Klimabelastung auf nahezu Null. Zudem können Kugelmühlen dezentral betrieben werden. Jeder Landwirt könnte sein eigenes Ammoniak produzieren, sagen die südkoreanischen Entwickler.
„Diese Technologie verbessert die Effizienz der Ammoniakproduktion unter Niedrigtemperatur- und Niederdruckbedingungen erheblich“, sagt Baek. „Da wir recycelte Solarzellenabfälle nutzt, trägt sie sowohl zur Dekarbonisierung als auch zur Ressourcenkreislaufwirtschaft bei und ist somit eine umfassende Lösung für die nachhaltige Ammoniakproduktion.“
Ammoniak als Dünger und Wasserstofftransporteur
Ammoniak ist das Ausgangsmaterial für so genannten Stickstoffdünger, ohne den es nicht möglich ist, die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen, die heute vor allem durch Kriege gefährdet ist. Weil die Zahl der Menschen weiter ansteigt wird der Düngerbedarf noch steigen und damit die Ammoniakproduktion.
Dazu kommt eine neue Aufgabe für das stechend riechende Gas. Das es pro Molekül drei Wasserstoffatome besitzt, ist es ein idealer Transporteur für den Energieträger der Zukunft. Anders als Wasserstoff, der unter hohem Druck – bis zu 800 bar – oder tiefgekühlt auf minus 253 Grad Celsius transportiert werden müsste, verflüssigt sich Ammoniak bereits bei minus 33 Grad.
In dieser Form kann Wasserstoff über weite Entfernungen transportiert werden, etwa aus Australien, Nordafrika, Namibia und Südamerika, also aus Ländern, die viel Sonnen- und Windstrom und damit Wasserstoff für die Industriestaaten produzieren können.
Ein Beitrag von: