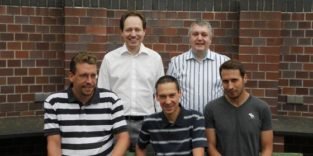Schutz vor Korrosion für Hightechmetalle
Metalle haben es schwer – überall lauern chemische Substanzen und technische Verfahren, die es rosten, durchlöchern oder zu Pulver zerbröseln wollen. Und die Situation verschärft sich, weil sie immer höhere Temperaturen aushalten müssen. Frankfurter Forscher haben jetzt verblüffende Verfahren gefunden, wie man Metalle trotzdem vor Korrosion schützen kann.
Würde man den Wirkungsgrad aller Kohlekraftwerke weltweit nur um 1 % verbessern, würde das die Atmosphäre um jährlich 200 Mio. t CO2 entlasten. Moderne Kohlenmeiler arbeiten daher mit höheren Temperaturen. Damit die Stähle den Hitzestress aushalten, müssen sie geschützt werden, heute meist durch einen ausgeklügelten Mix verschiedener Metalle oder – im Falle der noch heißeren Gasturbinen – durch keramische Schutzschichten. Doch die haben Nachteile: Ein Sandwichaufbau führt bei extremen Temperaturen zu mechanischen Spannungen, die Schutzschicht kann abplatzen.
Doch es geht auch anders. Wie, das berichtete Michael Schütze, Leiter des Karl-Winnacker-Instituts der Dechema, unlängst auf dem Kongress „Materialien für Energie“ in Karlsruhe. Schützes Team hat vier völlig neue Ansätze entwickelt, wie man Metalle vor Korrosion schützen kann. Alle vier sind noch Grundlagenforschung, haben aber so viel Potenzial, dass die Dechema-Forscher mit baldiger Anwendung rechnen.
Strategie Nummer eins entsprang einem Fehler im Labor: Einer von Schützes Doktoranden hatte Proben aus Titanaluminium mit einem Filzstift markiert und vergessen, die Ziffern vor dem Erhitzen im Ofen mit Alkohol abzuwischen. Nach dem Backen bei 900 °C stellte sich heraus, dass das Metall korrodiert war, nur nicht unter der Beschriftung. Tests ergaben, dass Halogene wie Chlor oder Fluor in der Tinte in die Oberfläche eindringen und die chemischen Prozesse durcheinanderbringen. Die Halogene sorgen dafür, dass sich eine dünne Aluminiumoxidschicht bildet, wie sie auch Aluminium vor dem Rosten schützt.
Weitere Tests waren verblüffend: Ein Abgasturbolader aus halogeniertem Titanaluminium überstand stundenlange Hitze von 1050 °C ohne Makel, während ein nichthalogenierter Turbolader komplett zerfressen aus dem Ofen kam.
Die Erfindung kommt zur rechten Zeit, denn die Automobilindustrie möchte die leichten Metalle gerne in Turboladern einsetzen, die Flugzeugbauer stehen in den Startlöchern. General Electric hat bereits eine Triebwerksturbine mit Titanaluminium entwickelt. Auch Nickelbasislegierungen, wie sie in Gasturbinen eingesetzt werden, lassen sich mit der Halogenbehandlung schützen.
Zu besonders fieser Korrosion kann es kommen, wenn Metalle hoch kohlenstoffhaltigen Energieträgern unter Sauerstoffabschluss ausgesetzt werden, was zum Beispiel bei Vergasungsprozessen der Fall ist. Beim sogenannten „Metal Dusting“ zerfällt das Metall förmlich zu Staub. Auch dafür haben die Frankfurter Forscher eine Gegenstrategie gefunden. „Wir vergiften die Metalloberfläche mit Zinn“, sagt Werkstoffwissenschaftler und Ingenieur Schütze.
In diesem Fall wird das Metall in zinnhaltiges Pulver gelegt und bei 1000 °C im Ofen gebacken. Dabei scheidet sich eine zinnreiche Oberflächenschicht ab, die nur wenige Atomlagen dünn ist und den Metallkörper nicht verändert, aber ausreicht, um den Angriff der Kohlenstoffatome abzuwehren und damit das Metal Dusting zu verhindern.
Schutzschichten gegen Korrosion gibt es heute schon: Sind sie verbraucht, werden sie entfernt und neu aufgebracht. Doch wann ist die Schutzschicht verbraucht? Das Problem geht Strategie drei aus dem Karl-Winnacker-Institut an: Die Dechema-Wissenschaftler bringen in einem zweistufigen Prozess eine 40 µm dicke Reservoirschicht aus ferromagnetischem Aluminiumchromnitrid auf.
Die Schicht schützt die Oberfläche, wird jedoch über Tausende Stunden in der Hitze verbraucht. Dabei nimmt auch der Magnetismus ab – fällt das magnetische Feld unter einen kritischen Wert, muss die Schicht erneuert werden. Allerdings: Das Magnetfeld ist so gering, dass man es bei der heutigen Geometrie der Turbinen noch nicht im laufenden Betrieb messen kann. Eine neue Messtechnik, die das Frankfurter Institut mit der Universität Kiel entwickelt, könnte vielleicht eines Tages die laufende Messung des Zustands der Schutzschicht ermöglichen.
Nahe an der technischen Umsetzung ist ein Projekt aus dem Institut, das die EU fördert. „Die EU drängt, dass wir in den nächsten zwei Jahren die technische Umsetzbarkeit zeigen“, verrät Schütze. Bei dem Konzept wird nano- beziehungsweise mikroskaliges Aluminiumpulver über einen Tauchprozess als Vorläuferschicht für eine Wärme-dämmschicht auf die Rotorblätter von Gasturbinen aufgebracht.
Wärmedämmschichten aus keramischen Verbindungen sind schon heute nötig, weil die Metalle der Rotoren in Gasturbinen die Hitze von bis zu 1400 °C sonst gar nicht aushalten würden. Doch im Frankfurter Konzept handelt es sich nicht um eine kompakte Keramikschicht, sondern um einen keramischen Schwamm aus Aluminiumoxid, das sich durch Oxidation aus dem metallischen Aluminiumschwamm der Vorläuferschicht bildet.
Die Entwicklung dieses Schichtsystems ist ein Abfallprodukt der Sprengstoffforschung, wo feinste hochexplosive Aluminiumpulver entwickelt wurden. In einem organischen Binder sind diese aber ungefährlich. Der Binder wird nach Aufbringen der Schicht während der Versinterung des Aluminiumpulvers zu Aluminiumschwamm verdampft. Mit von der Partie sind Experten des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologien in Pfinztal. Das Pulver bekommen die Frankfurter eigens aus einem Sprengstoffforschungszentrum im sibirischen Tomsk.
Der Schaum allein würde jedoch nicht ausreichen. Er sorgt nur für die Wärmedämmung. Das Metall darunter korrodiert weiter, weil der Schwamm durchlässig ist. Im gleichen Arbeitsgang diffundiert daher Aluminium unter den keramischen Schaum in den Werkstoff und schützt so das Material auch gegen Korrosion. Michael Schütze setzt auf eine Kombination verschiedener Strategien. „Ideal wäre ein keramischer Schaum und darunter eine ferromagnetische Reservoirschicht, die gleichzeitig als Korrosionsschutz und Verschleißanzeige fungiert.“
BERND MÜLLER
Ein Beitrag von: