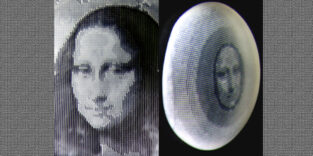Röntgenblick in die Bronzezeit: Was 5000 Jahre alte Schlacke verrät
MIT-Ingenieure nutzen CT-Scans, um 5000 Jahre alte Metall-Schlacke zu analysieren. Die Technik offenbart Details antiker Fertigung, ohne Zerstörung.

Wie haben die Menschen in der Bronzezeit Waffen und Werkzeuge aus Metall hergestellt? CT-Scans von 5000 Jahre alter Schlacke geben darüber Auskunft.
Foto: Smarterpix / KLYONA
Forschende des Massachusetts Institute of Technology (MIT) setzen medizinische Computertomographie (CT) ein, um 5000 Jahre alte Verhüttungsabfälle aus dem Iran zu untersuchen. Die Methode ermöglicht einen zerstörungsfreien Blick in das Innere antiker Kupferschlacke. Dies liefert präzise Daten über frühe Fertigungsprozesse, ohne wertvolle Artefakte blind zerschneiden zu müssen. Die Kombination aus CT und chemischer Analyse bietet neue Einblicke in die Anfänge der Metallurgie.
Inhaltsverzeichnis
Das Dilemma der Archäometallurgie
Die Archäometallurgie steht oft vor einem Dilemma. Um die chemische Zusammensetzung und die Mikrostruktur von Fundstücken zu verstehen, müssen Experten diese meist zerschneiden oder zermahlen. Bei seltenen Artefakten ist dies keine Option. Selbst bei Abfallprodukten wie Schlacke ist jeder Schnitt ein Risiko. Man zerstört unwiederbringlich Informationen, ohne zu wissen, ob man an der richtigen Stelle sucht.
Ein Team um Antoine Allanore und Benjamin Sabatini hat nun im Fachmagazin PLOS One einen Ansatz vorgestellt, der dieses Problem umgeht. Sie untersuchten Schlackenreste aus der archäologischen Stätte Tepe Hissar im Nordosten des Iran. Die Proben stammen aus der Zeit zwischen 3100 und 2900 vor Christus. Die Forschenden beweisen, dass moderne Bildgebungsverfahren, die eigentlich für die Diagnose von Knochenbrüchen oder Tumoren gedacht sind, auch die „Patientenakte“ der frühen Metallurgie lesen können.
Der Abfall als Informationsspeicher
Für das ungeschulte Auge wirkt Schlacke wie wertloser Gesteinsschrott. Für Ingenieure und Materialwissenschaftler ist sie jedoch ein gefrorener Moment der Geschichte. Schlacke entsteht, wenn Erz erhitzt wird. Sie trennt sich als flüssige Gesteinsmasse vom metallischen Kupfer ab. In ihr finden sich Reste der originalen Mineralien, Flussmittel wie Kalkstein und nicht reagierte Metalleinschlüsse.
„Auch wenn Schlacke uns vielleicht kein vollständiges Bild vermittelt, erzählt sie doch Geschichten darüber, wie frühere Zivilisationen Rohstoffe aus Erz zu Metall veredeln konnten“, erklärt Postdoktorand Benjamin Sabatini. Er sieht in den glasartigen Brocken ein Zeugnis technischer Fähigkeiten. „Sie zeugt von den technologischen Fähigkeiten der Menschen zu jener Zeit und liefert uns viele Informationen. Das Ziel ist es, von Anfang bis Ende zu verstehen, wie sie diese glänzenden Metallprodukte hergestellt haben.“
Das Problem bei der Analyse liegt in der Heterogenität des Materials. Schlacke ist chemisch komplex. Sie enthält alles, was die damaligen Metallurgen im Endprodukt nicht haben wollten. Dazu gehört oft Arsen, ein Begleitelement vieler Kupfererze.
CT-Scan als Navigationssystem für Materialforscher
Hier kommt die Computertomographie ins Spiel. Die Technik basiert auf Röntgenstrahlung. Sie durchdringt das Objekt und wird je nach Dichte des Materials unterschiedlich stark abgeschwächt. Ein Computer errechnet aus tausenden Schnittbildern ein dreidimensionales Modell. In der Studie kombinierten die Forschenden diese Scans mit klassischen Methoden wie der Röntgenfluoreszenz und der Elektronenmikroskopie.
Der entscheidende Vorteil: Die CT-Bilder fungieren als Landkarte. Archäologen mussten bislang oft raten, wo ein Schnitt die besten Ergebnisse liefert. Man wusste oft nicht einmal, wo bei einem Brocken Schlacke oben oder unten war, als er erkaltete. Der Scan ändert das. Er zeigt Poren, Gaseinschlüsse und vor allem kleine Metalltröpfchen, sogenannte „Prills“, die im Gestein gefangen sind.
„Meine Strategie bestand darin, mich auf die hochdichten Metalltröpfchen zu konzentrieren, die noch intakt aussahen, da diese möglicherweise am repräsentativsten für den ursprünglichen Prozess waren“, sagt Sabatini. „Dann konnte ich die Proben mit einem einzigen Schnitt zerstörend analysieren. Die CT-Scans zeigen Ihnen genau, was am interessantesten ist, sowie den allgemeinen Aufbau der Dinge, die Sie untersuchen müssen.“
Was die Scans verraten
Die Bilder aus dem Tomographen offenbarten komplexe Innenstrukturen. Die Forschenden konnten Bereiche mit hoher Dichte – also metallische Einschlüsse – klar von der weniger dichten Silikatmatrix der Schlacke unterscheiden. Diese Unterscheidung ist für die Rekonstruktion des Verhüttungsprozesses zentral.
Die Analyse der Porenverteilung gab zudem Hinweise auf die Gasentwicklung während der Schmelze. Dies lässt Rückschlüsse auf die Temperaturführung und die Viskosität der Schmelze zu. War die Schlacke flüssig genug, damit sich das Kupfer absetzen konnte? Wurde die Temperatur lange genug gehalten? Solche Fragen lassen sich durch die 3D-Visualisierung besser beantworten als durch die bloße Betrachtung der Oberfläche.
Besonders interessant ist die Rolle von Arsen. Tepe Hissar ist bekannt für frühe Arsenbronzen. Die Frage, ob Arsen bewusst legiert wurde oder zufällig im Erz vorhanden war, beschäftigt die Fachwelt seit Langem. Allanore weist auf die chemischen Tücken hin: „In der Archäometallurgie stellte sich schon immer die Frage, ob wir Arsen und ähnliche Elemente in diesen Überresten nutzen können, um etwas über den Metallproduktionsprozess zu erfahren.“
Die Herausforderung: Arsenverbindungen sind instabil. Sie können im Laufe von Jahrtausenden auswittern oder sich innerhalb der Schlacke verlagern. Die Studie zeigte, dass Arsen in den Proben sehr ungleich verteilt war. Es fand sich in verschiedenen Phasen und neigte dazu, sich zu bewegen oder ganz zu entweichen. Die CT-Daten helfen nun zu verstehen, welche Bereiche der Schlacke durch Verwitterung verändert wurden und welche noch den originalen Zustand von vor 5000 Jahren widerspiegeln.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Die Hürde für den Einsatz dieser Technik waren bisher die Kosten und die Verfügbarkeit. Medizinische CT-Scanner stehen selten in archäologischen Instituten. Das Team vom MIT arbeitete daher mit einem lokalen Start-up in Cambridge zusammen, das industrielle CT-Systeme entwickelt. Zudem nutzten sie Anlagen auf dem Campus.
Diese Kooperation zwischen Materialwissenschaft, Ingenieurwesen und Archäologie eröffnet neue Perspektiven für die Erforschung des kulturellen Erbes. Antoine Allanore, der auch Direktor des MIT-Zentrums für Materialforschung in Archäologie und Ethnologie ist, betont die Bedeutung der Fundstätte: „Die frühe Bronzezeit ist eine der frühesten bekannten Interaktionen zwischen Mensch und Metall. Artefakte aus dieser Region und dieser Zeit sind für die Archäologie äußerst wichtig, doch die Materialien selbst sind hinsichtlich unseres Verständnisses der zugrunde liegenden Materialien und chemischen Prozesse nicht sehr gut charakterisiert.“
Ein Beitrag von: