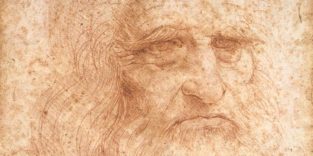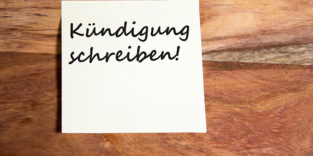So kämpft ZF gegen den Absturz – und das droht jetzt
ZF steckt tief in der Krise: Verluste, Stellenabbau, Proteste. Wo es hakt – und wie es für den Autozulieferer weitergehen soll.

Mitarbeiter der ZF Friedrichshafen demonstrieren vor dem Forum des Automobilzulieferer-Konzerns.
Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle
ZF Friedrichshafen steckt in einer tiefen Krise. Der Autozulieferer schreibt rote Zahlen, kämpft mit Milliarden-Schulden und will bis 2028 rund 14.000 Stellen in Deutschland streichen. Besonders betroffen ist die Antriebssparte. Die Ursachen sind vielfältig: eine schwächelnde Autobranche, hohe Investitionen in Elektromobilität und steigende Zinsen. Mitarbeitende protestieren, der Betriebsrat fordert einen Kurswechsel – doch das Management setzt den Sparkurs fort. Die nächsten Monate dürften entscheidend für die Zukunft des Unternehmens sein.
Inhaltsverzeichnis
- Zweiter Jahresverlust in Folge droht
- Weltweite Auto-Krise trifft auch ZF
- Schuldenlast drückt – Zinswende verschärft Lage
- Tausende Jobs in Gefahr – und kein Ende in Sicht
- „Division E“ – das Sorgenkind im Zentrum der Debatte
- Verhandlungen mit offenem Ausgang
- Saarland besonders betroffen – Zukunft bleibt unklar
- Hoffnungsträger mit Hindernissen: ZF Lifetec und neue Partnerschaften
- Wie steht ZF im Branchenvergleich da?
Zweiter Jahresverlust in Folge droht
Der Druck auf ZF Friedrichshafen wächst. Der zweitgrößte deutsche Autozulieferer ist tief in den roten Zahlen. Bereits zum zweiten Mal in Folge droht ein Jahresverlust. Im ersten Halbjahr 2025 summierte sich das Minus auf 195 Millionen Euro. Konzern-Finanzchef Michael Frick stellte klar: „Da die Märkte sehr instabil sind, gehen wir davon aus, dass wir auch im Gesamtjahr einen Verlust realisieren werden.“
Klar ist: Der Weg aus dem Krisenmodus wird kein kurzer sein. Zu groß sind die Herausforderungen – wirtschaftlich wie strukturell. Und zu tief reichen die Ursachen, die ZF in diese Schieflage gebracht haben.
Weltweite Auto-Krise trifft auch ZF
Die Schwäche der gesamten Autobranche ist ein zentrales Problem. Die globale Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen ist seit 2018 um rund 30 % zurückgegangen. Als Zulieferer trifft ZF das besonders hart, denn das Unternehmen lebt von Aufträgen der großen Hersteller – allen voran Volkswagen, BMW und Stellantis. Wenn bei ihnen die Bänder langsamer laufen, stehen auch die Maschinen in Friedrichshafen und anderswo still.
Dabei hat ZF viel zu bieten: Das Unternehmen entwickelt und produziert Getriebe, Lenksysteme, Bremsen, Fahrwerkskomponenten und komplette Antriebe – vom klassischen Verbrenner bis zum Elektroantrieb. Doch der technologische Wandel zur Elektromobilität kostet nicht nur Geld, sondern bringt auch Unsicherheiten mit sich. Viele Autohersteller halten sich mit Bestellungen zurück oder planen kurzfristiger als früher.
Schuldenlast drückt – Zinswende verschärft Lage
ZF trägt zusätzlich eine große finanzielle Last: hohe Schulden. Ende Juni 2025 lag die Netto-Verschuldung bei rund 10,5 Milliarden Euro. Hauptursache sind frühere Zukäufe – insbesondere die Übernahmen des US-Zulieferers TRW und des Bremsenherstellers Wabco. In den Jahren der Nullzinspolitik war die Finanzierung günstig. Doch heute zahlt ZF nach eigenen Angaben im Schnitt rund 4,5 % Zinsen. Das bedeutet: Hunderte Millionen Euro jährlich fließen nicht in Entwicklung oder Transformation, sondern an Gläubiger.
Finanzchef Frick schließt nicht aus, dass die Verschuldung noch weiter steigt. Das macht Sparen zu einer der wenigen Stellschrauben – mit spürbaren Folgen für die Beschäftigten.
Tausende Jobs in Gefahr – und kein Ende in Sicht
ZF befindet sich mitten in einem harten Sparkurs. Seit Anfang 2024 hat das Unternehmen weltweit rund 11.200 Vollzeitstellen gestrichen – davon 5.700 in Deutschland. Weitere 4.700 Jobs sollen über Altersteilzeit oder regulären Ruhestand abgebaut werden. Und das ist noch nicht das Ende: Bis Ende 2028 könnten in Deutschland bis zu 14.000 Stellen wegfallen – etwa jeder vierte Arbeitsplatz.
Konzernchef Holger Klein macht kein Geheimnis daraus, dass der Sparkurs weitergeht. Betriebsbedingte Kündigungen? Nicht ausgeschlossen. Eine schnelle Entwarnung für die Belegschaft? Fehlanzeige. Klein formuliert es so: „Damit ist ZF auf einem zwar schwierigen, aber erkennbar richtigen Weg.“ Für die Mitarbeitenden klingt das wie eine Durchhalteparole.
Auch Arbeitszeitverkürzungen gehören zum Programm. Betroffen sind nicht nur Produktionsmitarbeitende, sondern auch Beschäftigte in der Verwaltung. Viele verzichten auf Lohnbestandteile – zum Teil sogar Führungskräfte. Die Stimmung im Konzern ist angespannt.
„Division E“ – das Sorgenkind im Zentrum der Debatte
Besonders hart trifft es die Antriebssparte, intern „Division E“ genannt. Hier steckt die Transformation von ZF fest. Zwar umfasst dieser Bereich auch Elektromotoren, doch ein Großteil des Geschäfts hängt nach wie vor am klassischen Verbrenner – einem Segment mit schrumpfenden Margen und rückläufiger Nachfrage.
Allein die „Division E“ erwirtschaftet etwa ein Viertel des Konzernumsatzes. Zugleich gilt sie als nicht wettbewerbsfähig – vor allem wegen hoher Kosten und schwacher Rendite. Weltweit arbeitet etwa jede*r fünfte ZF-Beschäftigte in diesem Bereich. Ein Strategiewechsel steht im Raum. Der Konzern prüft eine Neuausrichtung, die mehrere Optionen offenlässt: interne Restrukturierung, externe Partnerschaft oder sogar ein Verkauf.
Diese Perspektiven alarmieren Betriebsrat und Gewerkschaften. Die IG Metall warnte zuletzt: „Der ZF darf nicht das Herz herausgerissen werden.“ Ein klarer Appell an das Management, die Kernsparte nicht aufzugeben. Der Protest gipfelte in einem bundesweiten Aktionstag mit über 10.000 Teilnehmenden – ein seltenes Signal dieser Deutlichkeit.
Verhandlungen mit offenem Ausgang
Tatsächlich haben die Proteste erste Wirkung gezeigt: Konzernführung und Arbeitnehmervertretung haben sich auf Gespräche verständigt. Beide Seiten wollen bis Ende September 2025 eine tragfähige Lösung für die Antriebssparte erarbeiten – dokumentiert in einer gemeinsamen Vereinbarung mit den zuständigen Gremien.
Ein Erfolg ist das noch nicht. Betriebsrat und IG Metall lehnen sowohl Ausgliederung als auch Verkauf ab. Sie pochen auf eine tragfähige Restrukturierung innerhalb des Konzerns. Holger Klein hingegen kündigte „erneute schmerzhafte Entscheidungen“ an. Der Ton ist sachlich, doch die Gräben sind tief. In den kommenden Wochen dürfte sich entscheiden, ob eine Einigung möglich ist – oder ob sich der Konflikt verschärft.
Saarland besonders betroffen – Zukunft bleibt unklar
Ein Beispiel für die Unsicherheit: der Standort Saarbrücken. Hier arbeiten etwa 8.500 Beschäftigte für ZF. Für viele steht nicht nur der Arbeitsplatz, sondern die wirtschaftliche Existenz einer ganzen Region auf dem Spiel. Konzernchef Klein erklärte, es gebe keine konkreten Schließungspläne, doch eine Garantie für den Fortbestand der Werke gibt es ebenfalls nicht. Auch hier heißt es nur: Man prüfe Optionen.
Solche Aussagen reichen der Belegschaft nicht. Auf mehreren Betriebsversammlungen machten Mitarbeitende ihrem Ärger Luft. Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich äußerte sich deutlich: „Man steht heute nicht besser da als vor den bisherigen Sanierungsrunden.“ Die bisherige Strategie habe zu keiner Stabilisierung geführt – im Gegenteil: „Viele Beschäftigte machen derzeit keine Mehrarbeit, weil es massive Eingriffe in ihre Löhne gibt.“ Die Unzufriedenheit wächst – das Vertrauen in die Konzernspitze sinkt.
Hoffnungsträger mit Hindernissen: ZF Lifetec und neue Partnerschaften
Ein weiteres Kapitel in der Neuausrichtung ist die frühere Division für passive Sicherheitstechnik. Sie wurde als ZF Lifetec ausgegliedert und produziert unter anderem Airbags und Sicherheitsgurte. Für diese Tochter sucht ZF derzeit einen strategischen Partner – bislang ohne Ergebnis. Ein möglicher Börsengang ist im Gespräch, aber nicht konkret angekündigt.
Auch in anderen Bereichen setzt der Konzern auf Kooperationen: So wurde der Geschäftsbereich Achsmontage in ein Joint Venture mit Foxconn überführt. Dieser Schritt hat den Umsatz im ersten Halbjahr 2025 rechnerisch sinken lassen – um 10,3 % auf 19,7 Milliarden Euro. Der Effekt ist buchhalterisch, da der Bereich nicht mehr konsolidiert wird. Operativ lief es besser: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 780 auf 874 Millionen Euro. Doch das reicht nicht, um den Gesamtkonzern aus den roten Zahlen zu führen.
Wie steht ZF im Branchenvergleich da?
ZF ist nicht allein. Auch andere deutsche Autozulieferer kämpfen mit rückläufigen Aufträgen, hoher Unsicherheit und wachsendem Reformdruck. Bosch, Continental und Schaeffler leiden unter denselben strukturellen Problemen – allen voran dem langsamen Hochlauf der Elektromobilität und der Transformation ihrer Geschäftsmodelle.
Doch während Bosch mit seiner Diversifikation in die Haushalts- und Industrietechnik breiter aufgestellt ist und Continental stark in Softwarelösungen investiert, fehlt ZF diese Flexibilität. Das Unternehmen hängt fast vollständig am Tropf der Autoindustrie. Der Versuch, mit der Übernahme von TRW und Wabco neue Kompetenzen ins Haus zu holen, hat hohe Schulden verursacht – ohne die erhoffte Entlastung beim Cashflow. Zinssteigerungen verschärfen das Problem.
ZF ist zwar groß, aber nicht unbeweglich. Doch anders als börsennotierte Konkurrenten steht das Stiftungsunternehmen unter besonderem Handlungsdruck, was finanzielle Transparenz und Flexibilität angeht. Strategische Kurswechsel dauern länger. Und sie erfordern ein sensibles Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und sozialer Verantwortung. (mit dpa)
Ein Beitrag von: