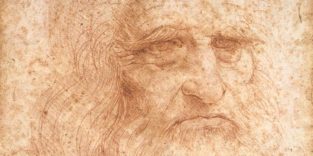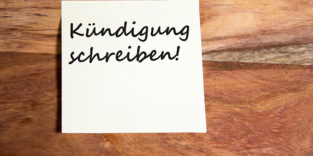Digitalminister ohne Politikerfahrung – kann Wildberger Deutschland digital machen?
Er war vermutlich die größte Überraschung in der neuen Ministerriege der CDU: Karsten Wildberger wird Digitalminister. Viele Beobachter rechneten mit einer anderen Besetzung. Wer ist der Mann an der Spitze des neuen Ministeriums? Und was sind seine Aufgaben?

Mit reichlich Verspätung "gönnt" die Regierung der Digitalisierung ein eigenes Ministerium. Als Kopf haben sie einen Mann aus der Wirtschaft auserkoren, was für einige Kontroversen sorgt.
Foto: PantherMedia / Karsten Ehlers
Mit Karsten Wildberger wird ein bisher parteipolitisch unerfahrener Topmanager zum neuen Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung ernannt. Die Entscheidung gilt als Überraschung und signalisiert einen unternehmerischen Kurs der neuen CDU-geführten Bundesregierung unter Friedrich Merz. Wildberger, promovierter Physiker und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Ceconomy AG, soll die Digitalisierung Deutschlands entscheidend voranbringen. Dazu gehört die Modernisierung der Verwaltung, der Breitbandausbau, eine zentrale Bürgerplattform und der KI-Ausbau.
Inhaltsverzeichnis
- Wer ist der neue Digitalminister?
- Politisch ein unbeschriebenes Blatt
- Digitales: Bislang ein Stiefkind unter den Ministerien
- Digitale Agenda von 2014
- Digitalstrategie der Bundesregierung 2022
- Aufgaben und Zuständigkeiten des neuen Digitalministeriums
- Wie ist der Status Quo bei Digitalministerien in anderen EU-Staaten?
- Das sind die Herausforderungen für den Digitalminister
Wer ist der neue Digitalminister?
Karsten Wildberger übernimmt mit seiner Ernennung am 28. April 2025 offiziell das neu geschaffene Digitalministerium, das am 6. Mai 2025 offiziell gegründet werden soll. Geboren am 5. September 1969 in Gießen, studierte Wildberger Physik an der TU München und der RWTH Aachen, wo er auch promovierte.
Seine berufliche Laufbahn begann der designierte Digitalminister bei der Boston Consulting Group. Anschließend hatte er internationale Führungspositionen bei T-Mobile, Vodafone und dem australischen Telekommunikationsunternehmen Telstra inne. Von 2016 bis 2021 war er Vorstandsmitglied bei E.ON SE, wo er unter anderem für Vertrieb, Marketing, Kundenlösungen, digitale Transformation und IT verantwortlich war. Seit August 2021 ist Wildberger Vorstandsvorsitzender der Ceconomy AG und Geschäftsführer der Media-Saturn-Holding GmbH, zu der die Elektronikhändler MediaMarkt und Saturn gehören. In dieser Rolle leitete er die digitale Transformation des Unternehmens.
Politisch ein unbeschriebenes Blatt
Politisch ist Karsten Wildberger ein eher unbeschriebenes Blatt. Er ist ein erfahrener Topmanager, der bislang nicht durch politische Ämter in Erscheinung getreten ist. Allerdings engagiert er sich seit 2017 ehrenamtlich im CDU-Wirtschaftsrat. Seine Berufung wird von Branchenexpertinnen und -experten als Signal gewertet, dass die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz die Digitalisierung mit einem Blick von außen und unternehmerischer Kompetenz vorantreiben möchte.
Andere Stimmen wiederum kritisieren, dass mit dem Unternehmer auch ein Lobbyist zum Minister gemacht werde. Wildberger selbst äußerte sich geehrt über das Vertrauen und die Möglichkeit, das neue Digitalministerium zu leiten. Unterstützung bekommt er von Philipp Amthor (CDU), der als Staatssekretär ins neue Ministerium einziehen soll.
Digitales: Bislang ein Stiefkind unter den Ministerien
Auf den neuen Digitalminister wird einiges an Arbeit zukommen. Offiziell heißt sein neues Ressort “Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung”. Unter diesem Dach muss er bündeln, wofür bislang verschiedene Stellen zuständig waren. Nominell war die Digitalisierung bislang ein Anhängsel des Ministeriums für Digitales und Verkehr.
Das war aber diesbezüglich ausschließlich für den Netzausbau zuständig. Das Bundesinnenministerium kümmerte sich um die Digitalisierung der Verwaltung. Für den Datenschutz sind (noch) die Datenschutzbehörden von Bund und Ländern zuständig. Themen rund um Künstliche Intelligenz sind aktuell aufgeteilt zwischen dem Forschungsministerium und dem Wirtschaftsministerium.
Digitale Agenda von 2014
Erstmals relevant wurde die Digitalisierung in der Legislaturperiode 2013 bis 2017. Im August 2014 stellte die Bundesregierung die „Digitale Agenda“ vor, ein ressortübergreifendes Arbeitsprogramm zur Gestaltung der Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Damit wurde die Digitalisierung offiziell zur Querschnittsaufgabe erklärt, an der 14 Fachressorts beteiligt waren – ein eigenes Digitalministerium gab es nicht.
Im März 2018 wurde das Amt der Staatsministerin für Digitalisierung geschaffen, das Dorothee Bär übernahm, die bisher einzige Person auf diesem Posten. Sie war direkt im Bundeskanzleramt angesiedelt und koordinierte Digitalthemen zwischen den Ressorts. Im selben Jahr wurde ein Kabinettsausschuss für Digitalisierung eingerichtet.
Digitalstrategie der Bundesregierung 2022
Die Ampelkoalition erklärte die Digitalisierung erneut zur Querschnittsaufgabe. Im August 2022 wurde die „Digitalstrategie der Bundesregierung“ verabschiedet, die Ziele bis 2030 formuliert und alle Ministerien einbezieht. Mit der Regierungsübernahme durch Friedrich Merz wird die Digitalisierung nun erstmals in einem eigenständigen Bundesministerium gebündelt.
Auf Ebene der Bundesländer verfügen bislang Bayern und Hessen über ein eigenes Digitalministerium. Laut einer Übersicht des Bundesinnenministeriums zählen beide Länder im Bereich der digitalen Verwaltung zu den fortschrittlichsten im Vergleich mit anderen Bundesländern.
Aufgaben und Zuständigkeiten des neuen Digitalministeriums
Folgende Digitalisierungspläne aus dem Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung könnten in die Zuständigkeit des neuen Ministeriums fallen (Hinweis: Welche Aufgaben tatsächlich in das Ressort fallen, wird voraussichtlich erst nach Vereidigung der neuen Regierung sowie der Gründung des Ministeriums am 6. Mai 2025 endgültig feststehen):
- Digitalisierung der Verwaltung: Das Digitalministerium übernimmt die Verantwortung für die digitale Transformation der Bundesverwaltung. Dazu gehören die Modernisierung von Registern und die Einführung nutzerfreundlicher digitaler Identitäten. Ziel ist eine effiziente, transparente und bürgernahe Verwaltung. Oder, wie es Lars Klingbeil ausdrückte: Weg mit den Faxgeräten. So soll beispielsweise eine digitale Agentur für Fachkräfteeinwanderung eingerichtet werden. Auch die einfache, barrierefreie und digitale Beantragung möglichst vieler Leistungen ist geplant
- Künstliche Intelligenz: Deutschland soll KI-Nation werden. Das bedeutet massive Investitionen in die Cloud- und KI-Infrastruktur sowie in die Verbindung von KI und Robotik. Die Regierung will Leichtbau-Technologie, additive Fertigung und 3D-Druck fördern.
- Digitale Infrastruktur: Das Digitalministerium wird voraussichtlich den Ausbau digitaler Infrastrukturen, insbesondere den Breitband- und Glasfaserausbau “bis in jede Mietwohnung” (wie es im Koalitionsvertrag heißt) betreuen.
- “Digital-Only“: Jeder Bürger und jede Bürgerin soll verpflichtend ein Bürgerkonto und eine digitale Identität erhalten. So sollen Verwaltungsleistungen unkompliziert digital über eine zentrale Plattform („One-Stop-Shop“) ermöglicht werden.
- Digitalisierung der Justiz: Die Bundesregierung will die Digitalisierung der Justiz fortführen. Im modernen digitalen Rechtsverkehr sollen Medienbrüche der Vergangenheit angehören. Gemeinsam mit den Ländern plant die Bundesregierung Standards für die Übermittlung digitaler Dokumente, einschließlich Behördenakten, an Gerichte und Staatsanwaltschaften.
- Reform des Datenschutzes: Die Bundesregierung will die Datenschutzaufsicht reformieren. Die Datenschutzkonferenz (DSK) wird im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verankert, um gemeinsame Standards zu entwickeln. Die Regierung plant, vorhandene Spielräume der DSGVO zu nutzen, um beim Datenschutz für einheitliche Auslegungen und Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen, Beschäftigte sowie das Ehrenamt zu sorgen. Der Digitalminister dürfte hier eine große Rolle spielen.
- Digital-Pakt 2.0: Damit will die Bundesregierung die digitale Infrastruktur und eine verlässliche Administration ausbauen. Es ist geplant, eine praxisnahe Lehrkräftebildung, die digitalisierungsbezogene Schul- und Unterrichtsentwicklung, selbstadaptive, KI-gestützte Lernsysteme sowie digital unterstützte Vertretungskonzepte zu fördern.
Wie ist der Status Quo bei Digitalministerien in anderen EU-Staaten?
Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben Ministerien oder Ministerposten geschaffen, die sich speziell mit digitalen Angelegenheiten befassen. Die Erfahrungen mit einem solchen Digitalministerium (das aber nicht überall so heißt) sind unterschiedlich:
- Estland: Gilt als Vorreiter der digitalen Verwaltung. Das Ministerium für Wirtschaft und Kommunikation koordiniert die digitale Transformation. Estland bietet umfassende Online-Dienste wie digitale Identitäten, E-Residency und Online-Wahlen an – selbst Scheidungen sind als letzte Behördenleistung im Januar 2025 digitalisiert worden.
- Frankreich: Verfügt über einen Staatssekretär für Digitales, der dem Premierminister unterstellt ist. Initiativen wie „France Connect“ bieten Bürgern einen zentralen Zugang zu digitalen Verwaltungsdiensten. Allerdings sind die Zuständigkeiten auf mehrere Behörden verteilt, was die Umsetzung erschwert.
- Finnland: Das Finanzministerium koordiniert die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Finnland erzielt regelmäßig Spitzenwerte im Digital Economy and Society Index (DESI) der EU und bietet umfassende digitale Dienste über das Portal suomi.fi an.
- Polen: Hat mit der App mObywatel eine digitale Identitätslösung eingeführt, die es Bürgern ermöglicht, digitale Versionen ihrer Ausweise zu nutzen und verschiedene Verwaltungsdienste in Anspruch zu nehmen. Die App hat mehr als acht Millionen Nutzer.
Das sind die Herausforderungen für den Digitalminister
Sobald öffentlich wurde, dass Deutschland ein Digitalministerium erhalten würde, meldeten sich Branchenexperinnen und -experten sowie Initiativen (z.B. die Konrad Adenauer Stiftung) und Verbände (etwa der Verband der Internetwirtschaft) zu Wort, die entsprechende Forderungen bezüglich der Digitalisierung stellten. Sie erwarten unter anderem:
- Modernisierung der Verwaltung: Die angekündigten Pläne klängen vielversprechend, blieben jedoch zu vage. Konkrete Zeitpläne für Registermodernisierung oder digitale Verwaltungsleistungen fehlten. Digitale Prozesse müssten zum Standard werden – mit klaren Zielen, ausreichenden Ressourcen und einem Rechtsanspruch auf digitale Verwaltung. KI könne dabei unterstützen.
- Cybersicherheit ausbauen: Wichtig sei die Umsetzung bestehender EU-Vorgaben. Klar definierte Rollen in der Cybersicherheit, eine Stärkung des BSI und dessen Ausbau zur Zentralstelle wären begrüßenswert. Das Digitalministerium müsse dafür bald konkrete Schritte benennen.
- Digitalstrategie: Für ein leistungsfähiges Digitalministerium brauche es ein ressortübergreifendes Zielbild, basierend auf dem Koalitionsvertrag und abgestimmt mit Gesellschaft und Wirtschaft. Es soll zentrale Schwerpunkte und messbare Benchmarks digitalpolitischer Vorhaben festlegen.
- KI-Standort Deutschland stärken: Der AI Act müsse innovationsfreundlich umgesetzt werden, mit besonderem Fokus auf KMU und Start-ups. Notwendig seien stabile digitale Infrastrukturen, gute Bedingungen für Rechenzentren und mehr Kapazitäten für KI-Training. Zusätzliche Haftungsregeln für KI lehnt die Internetwirtschaft ab.
- Rechtssicherheit schaffen: Das Digitalministerium solle auf einen verlässlichen Rechtsrahmen für Daten- und Digitalpolitik hinwirken. Das geplante Datengesetzbuch biete dafür eine Grundlage. Überwachung wie Vorratsdatenspeicherung untergrabe Vertrauen – stattdessen brauche es bessere Ausstattung und mehr Personal für Ermittlungsbehörden.
Deutschland verfehlt seine Digitalisierungsziele bislang deutlich: Ursprünglich sollten bis Ende 2022 sämtliche Verwaltungsleistungen online verfügbar sein – der Behördengang wäre damit überflüssig. Dieses Ziel ist bis heute nicht erreicht. Auf den bisherigen Unternehmer und künftigen Digitalminister Karsten Wildberger kommt viel Arbeit zu, die sich deutlich von seinen bisherigen Tätigkeiten unterscheiden wird.
Diese Erfahrung machte auch Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus, die 2022 in einem Interview erklärte, sie habe lernen müssen, dass Verwaltungshandeln umfassend abgesichert sein muss und mit einem Wirtschaftsunternehmen grundsätzlich nicht vergleichbar sei.
Ein Beitrag von: