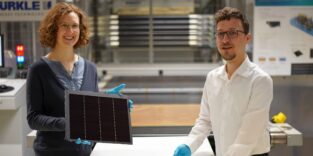Digitale Planung statt Flickwerk: Wärmenetze klimafit umbauen
Ein neues Planungstool soll Wärmepumpen leichter in bestehende Wärmenetze integrieren. Das Ziel: Dekarbonisierung beschleunigen.

Fernwärmeleitungen sollen künftig vermehrt mit klimafreundlicher Wärme aus Wärmepumpen gespeist werden.
Foto: Smarterpix / jeancliclac
In der Diskussion um die Wärmewende gilt Fernwärme als vielversprechende Option. Doch bislang stammt nur ein kleiner Teil dieser Energieform aus erneuerbaren Quellen. Etwa 30 % der Fern- und Nahwärme werden in Deutschland klimafreundlich erzeugt. Der Rest basiert auf Erdgas, Heizöl oder Kohle.
Sechs Millionen Haushalte beziehen ihre Wärme derzeit über ein Netz. Vorherrschend ist die Kraft-Wärme-Kopplung, bei der Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt werden. Blockheizkraftwerke (BHKW) nutzen dabei die Abwärme der Stromproduktion. Das klingt effizient, basiert aber meist auf fossilen Brennstoffen. Biogas oder Pflanzenöl spielen nur eine untergeordnete Rolle, da sie nur begrenzt verfügbar sind.
Inhaltsverzeichnis
Wärmepumpen als Alternative – aber aufwendig zu integrieren
Eine Möglichkeit, den fossilen Anteil zu senken, bieten Wärmepumpen. Sie entziehen Luft, Wasser oder dem Erdreich Umweltwärme und wandeln sie mit Strom in nutzbare Heizenergie um. Theoretisch ließe sich so ein erheblicher Teil fossiler Erzeuger ersetzen. Doch in der Praxis erweist sich der Umbau als kompliziert.
Gerade für kleine und mittlere Versorger sind fehlende Standards, technische Unsicherheiten und umfangreiche Genehmigungsverfahren eine große Hürde.
Projekt TrafoWärmeNetz soll den Umbau erleichtern
Genau hier setzt das Projekt „TrafoWärmeNetz“ an. Ein interdisziplinäres Forschungsteam entwickelt ein digitales Werkzeug, das die Planung von Wärmepumpen in Bestandsnetzen vereinfachen soll. Ziel ist es, den Umbau systematisch und standardisiert anzugehen.
Beteiligt sind unter anderem Drees & Sommer, das Fraunhofer ISE, die Hochschule München sowie Stadtwerke und Energieunternehmen. Die Projektleitung liegt bei Prof. Dr. Madjid Madjidi von der Hochschule München. Gefördert wird das Vorhaben vom Bundeswirtschaftsministerium.
Die Erwartungen sind groß. „Schätzungen nach können durch die nachhaltige Transformation der kleinen und mittleren Bestandsfernwärmenetze rund 200.000 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden“, sagt Madjidi. Bei flächendeckender Umsetzung seien sogar bis zu 10 Millionen Tonnen jährlich möglich.
Warum der Umbau bisher hakt
Die Idee klingt simpel: Alte Heizwerke raus, Wärmepumpen rein. Doch in der Realität ist es komplexer. Mathias Lanezki von Drees & Sommer fasst zusammen: „Vor allem kleineren und mittleren Wärmeversorgern fehlt es oft an technischem und planerischem Know-how, um ihre Wärmenetze zeit- und kosteneffizient umzurüsten. Hinzu kommen die bürokratischen Hürden.“
Ein weiteres Problem: Es fehlt an standardisierten Vorgehensweisen. Jeder Umbau ist bisher ein individueller Kraftakt. Das kostet Zeit, Geld und oft auch Nerven.
Werkzeug für die digitale Planung
Das Herzstück des Projekts ist ein digitales Planungstool. Es simuliert, wie Wärme in einem Netz verteilt wird und welche Technik sich dafür eignet. Dabei geht es nicht nur um Wärmepumpen, sondern auch um hybride Systeme, die mehrere Quellen kombinieren.
„Aktuell wissen viele Betreiber nicht, welche Potenziale ihre Netze haben oder wie sie diese technisch und wirtschaftlich sinnvoll umrüsten können“, sagt Lanezki. Oft fehlen grundlegende Daten. Diese Lücke soll das Tool schließen.
So funktioniert das digitale Werkzeug
Im ersten Schritt analysieren die Forschenden typische Bestandsnetze. Daraus leiten sie ab, welche Systemarchitekturen geeignet sind. Wann lohnen sich hybride Lösungen? Wann reicht eine reine Wärmepumpe? Welche Technik ist nötig und wie viel CO₂ spart das? Die Antworten fließen direkt in die Software ein.
Ein erster Demonstrator des Tools steht bereits. Er kann den Wärmebedarf eines einzelnen oder mehrerer Gebäude simulieren. Die Ergebnisse sind laut Projektteam mit etablierten Programmen wie IDA ICE vergleichbar. Dabei bleibt der Rechenaufwand gering.
Open-Source-Ansatz für mehr Flexibilität
Das Tool basiert auf frei zugänglicher Software. Die Ausgangsdaten stammen unter anderem aus OpenStreetMap. Damit lassen sich Netzstrukturen auf Basis georeferenzierter Daten erstellen. Für die Berechnungen kommen thermohydraulische Modelle zum Einsatz, die Druckverluste und Durchflussmengen im Netz analysieren.
Die Bedienung erfolgt bewusst mit Excel. Das macht die Nutzung einfacher und das System offen für weitere Anwendungen. Netzbetreiber benötigen dadurch keine umfassenden Programmierkenntnisse.
Praxisreif bis 2026?
Das Projekt läuft bis Ende 2026. Bis dahin soll das digitale Werkzeug voll einsatzbereit sein. Vor allem kleinere Versorgungsunternehmen sollen damit ihre Netze effizient und klimafreundlich umstellen können – ohne auf externe Beratung angewiesen zu sein.
Ziel ist es, Hemmnisse abzubauen und die Umstellung auf erneuerbare Wärmequellen planbarer zu machen. Mit klaren Standards, technischen Empfehlungen und simulationsgestützten Entscheidungen soll das gelingen.
Ein Beitrag von: