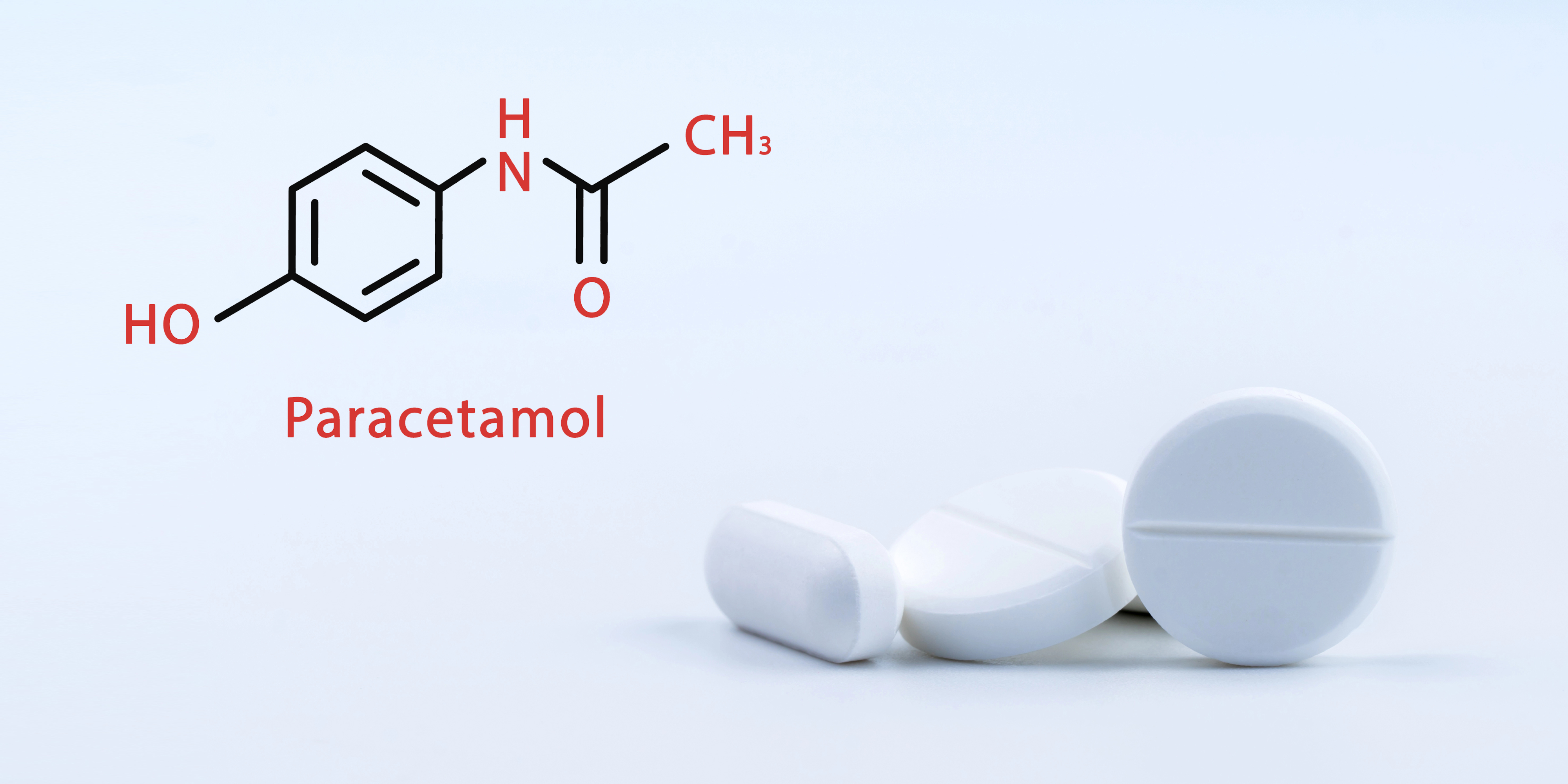Abkommen gescheitert: So lässt sich die Plastikflut technisch eindämmen
Scheitern des UN-Plastikabkommens: Folgen für Umwelt, Gesundheit und Recycling – und welche Lösungen jetzt gefragt sind.

Wachsende Müllberge: Das Plastikmüll-Abkommen ist vorerst gescheitert.
Foto: Smarterpix / sergioz
Das Ziel war ehrgeizig: ein globales, rechtsverbindliches Abkommen gegen die Plastikflut. Doch am 14. August 2025 scheiterte die Einigung in Genf – nach drei Jahren Verhandlungen. Rund 180 Staaten saßen am Tisch. Am Ende blieben die Fronten verhärtet. Ein Vertragsentwurf ohne klare Verpflichtungen fand keine Mehrheit. „Kein Abkommen ist in diesem Fall besser als eines, das den Status quo auf UN-Ebene zementiert“, sagt Florian Tize von der Umweltstiftung WWF.
Verena Graichen, Geschäftsführerin Politik beim BUND, bringt die Konsequenzen auf den Punkt: „Ohne ein ambitioniertes Plastikabkommen geht die Vermüllung unseres Planeten nun weiter. Die Öl-, Gas- und Chemieindustrielobbyisten haben in Überzahl in der Schweiz gewonnen – auf Kosten von uns allen.“
Inhaltsverzeichnis
Warum die Verhandlungen scheiterten
Die Lager waren klar getrennt. Über 100 Staaten, vereint in der sogenannten High Ambition Coalition, wollten die Plastikproduktion auf ein nachhaltiges Maß begrenzen, Einwegprodukte verbieten und Mehrwegsysteme fördern. Auf der anderen Seite stand die Like-Minded Group, zu der vor allem ölproduzierende Länder wie Saudi-Arabien, Iran und Russland gehören. Sie wollten sich auf besseres Abfallmanagement beschränken, ohne die Produktion einzuschränken.
Das ursprüngliche UN-Mandat aus dem Jahr 2022 sah vor, den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen zu regeln – von der Herstellung bis zur Entsorgung. Doch schon während der Verhandlungen in den letzten Monaten zeichnete sich ab, dass zentrale Punkte gestrichen werden könnten. Der letzte Entwurf enthielt nur noch vage Formulierungen. Für viele Staaten war das zu wenig.
Die technischen Herausforderungen
Plastik ist vielseitig und günstig herzustellen. Das macht ihn in Industrie, Bauwesen, Medizin und Verpackung unverzichtbar. Gleichzeitig erschwert diese Vielfalt das Recycling. Viele Produkte bestehen aus Mischkunststoffen oder enthalten Additive, die sich nur schwer trennen lassen. „Eine PET-Flasche lässt sich gut recyceln, aber viele Verpackungen sind aus mehrschichtigen Kunststoffen aufgebaut, die sich nur sehr schwer wieder trennen lassen“, erklärt die Meeresbiologin Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut.
Fehlende Recyclingkapazitäten verschärfen das Problem. Wenn der Preis für neu hergestelltes Plastik künstlich niedrig bleibt – unter anderem, weil fossile Rohstoffe steuerlich begünstigt werden –, können Recyclingbetriebe wirtschaftlich kaum mithalten. Branchenverbände wie BDE und FEAD fordern deshalb, diese Vorteile für Primärplastik abzuschaffen und die Einnahmen in den Ausbau von Recyclinganlagen zu investieren. Andernfalls drohen weitere Schließungen.
Die Hürden beim Recycling
Ein Kernproblem ist die Vielfalt der Kunststoffe. Manche lassen sich sortenrein und relativ einfach wiederverwerten – wie PET-Flaschen. Andere, etwa mehrschichtige Verpackungen, sind technisch kaum zu trennen. Ohne einheitliche Standards im Produktdesign stoßen selbst modernste Anlagen an ihre Grenzen.
Hinzu kommt die Preisfrage: Neuplastik ist oft billiger als Recyclingware, weil die wahren Umweltkosten nicht eingepreist werden. Branchenverbände wie BDE und FEAD schlagen deshalb vor, fossile Rohstoffe in der Kunststoffproduktion nicht länger steuerlich zu begünstigen. Die frei werdenden Mittel könnten in Recycling-Infrastruktur fließen.
„Bis 2060 müssen wir mit einer Verdreifachung der Plastikproduktion rechnen. Auch 2060 wird weniger als ein Fünftel des Materials recycelt werden können“, warnt BUND-Chefin Graichen. Ohne technische und wirtschaftliche Anreize wird diese Lücke kaum zu schließen sein.
Ökologische Risiken
Jährlich landen etwa 22 Millionen Tonnen Plastikmüll in der Natur. In Flüssen, an Stränden, in der Tiefsee – und mittlerweile auch in unseren Körpern. Mikro- und Nanoplastik wird in Organen, im Blut und sogar im Gehirn nachgewiesen. Studien zeigen mögliche Auswirkungen auf das Immunsystem, die Fruchtbarkeit und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Besonders in Entwicklungsländern fehlt eine funktionierende Abfallwirtschaft. Dort landet ein großer Teil des Abfalls unkontrolliert in der Umwelt oder wird unter einfachen Bedingungen verbrannt – oft ohne Filtertechnik. Dabei entstehen giftige Emissionen, die nicht nur Ökosysteme, sondern auch die Gesundheit der Bevölkerung gefährden.
Forschende untersuchen zudem, ob Plastik die Fotosynthese von Algen beeinträchtigen könnte. Das hätte Folgen für die gesamte Nahrungskette im Meer und würde auch die Fähigkeit der Ozeane verringern, CO₂ aufzunehmen.
Problematische Scheinlösungen
Immer mehr Unternehmen setzen auf sogenannte Plastic Credits – eine Art Ausgleichszahlung für Plastikmüll. Firmen finanzieren damit Projekte, die Kunststoffabfälle einsammeln. Doch das System hat Schwächen. Es zählt allein die Menge des eingesammelten Plastiks, unabhängig von Qualität oder Recyclingfähigkeit.
Das Beispiel eines Projekts in Indonesien zeigt die Risiken: Ein Teil der gesammelten Abfälle wurde zu Brennstoffbriketts verarbeitet und in einfachen Öfen verbrannt. Dabei gelangten Schadstoffe unkontrolliert in die Luft. Nach Protesten wurde das Projekt eingestellt. „Plastic Credits verschieben die Verantwortung vom Staat auf den Privatsektor“, warnt die Umweltwissenschaftlerin Sangcheol Moon. Langfristig verhindere das den Aufbau einer stabilen öffentlichen Abfallwirtschaft.
Was jetzt getan werden müsste
Trotz des Scheiterns gibt es Ansätze, die jetzt verstärkt werden könnten:
- Design for Recycling: Produkte von Beginn an so entwickeln, dass Materialien sortenrein trennbar sind.
- Erweiterte Herstellerverantwortung: Produzierende verpflichten, Rücknahmesysteme einzurichten und problematische Chemikalien zu vermeiden.
- Kreislaufwirtschaft fördern: Kunststoffe möglichst lange im Umlauf halten und fossile Rohstoffe ersetzen.
- Steuerliche Lenkung: Primärplastik verteuern, um Recyclingmaterial wettbewerbsfähig zu machen.
Gerade für Ingenieurinnen und Ingenieure bietet das Feld zahlreiche Herausforderungen – von der Entwicklung besserer Sortier- und Recyclingtechnologien bis hin zu neuen Materialrezepturen, die Leistung und Umweltverträglichkeit verbinden.
Kreislaufwirtschaft und umweltfreundlichere Additive
Ein weiterer Ansatz ist die Kreislaufwirtschaft. Dabei werden Kunststoffe möglichst lange im Nutzungskreislauf gehalten und nach dem Gebrauch als Rohstoff wiederverwendet. Das senkt den Bedarf an fossilen Rohstoffen und reduziert Abfall.
Auch die Entwicklung umweltfreundlicherer Additive kann helfen, problematische Chemikalien zu ersetzen. Hier ist Forschung gefragt – und ein klarer regulatorischer Rahmen, der Innovation nicht ausbremst, aber Risiken minimiert. (mit Material der dpa)
Ausblick
Das Scheitern in Genf ist ein Dämpfer für den globalen Umweltschutz. Doch es kann auch ein Anstoß sein, nationale und regionale Lösungen schneller voranzutreiben. Die Prognosen sind eindeutig: Ohne Eingriffe wächst die Plastikflut weiter – mit Folgen, die Technik, Gesundheit und Natur gleichermaßen betreffen.
„Wir fordern deshalb eine Begrenzung der Plastikproduktion und das Verbot nachweislich schädlicher Chemikalien“, sagt Graichen. Die nötigen Technologien sind da – jetzt braucht es den politischen Willen, sie auch einzusetzen.
Weiterführende Informationen:
Ein Beitrag von: