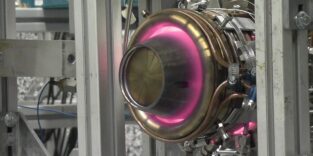Wasserstoff aus der Wüste: Was Namibia wirklich liefern kann
Sonne, Wind, aber wenig Wasser: Namibia könnte Wasserstoff-Lieferant werden. Neue Studien zeigen Potenziale und Probleme.

Namibia möchte sich als Exporteur von grünem Wasserstoff positionieren. Drei aktuelle Studien beschäftigen sich mit den Chancen und Risiken.
Foto: Smarterpix / EcoPic
Namibia ist ein Land der Gegensätze. Es hat mehr Sonnenstunden als die meisten Regionen der Welt, kräftige Winde vom Atlantik – und gleichzeitig extreme Trockenheit. Genau diese Mischung macht es zum Hoffnungsträger der globalen Energiewende. Grüne Moleküle aus der Wüste könnten in Zukunft Tanker und Fabriken in Europa antreiben. Doch der Traum vom großen Exportgeschäft ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Neue Studien zeigen, dass Chancen und Risiken eng beieinander liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Warum Namibia ins Rampenlicht rückt
- Wie alles begann
- Was produziert werden könnte
- Wasser – der limitierende Faktor
- Die unterschätzte Ressource Sole
- Logistik und Export – ohne Häfen geht nichts
- Arbeitsplätze und Wertschöpfung
- Internationale Partner – Chance und Risiko
- Umwelt und Gesellschaft im Blick behalten
- Zahlen und Szenarien
- Was jetzt nötig ist
Warum Namibia ins Rampenlicht rückt
Das Land im südlichen Afrika importiert bislang einen Großteil seines Stroms aus Nachbarstaaten. Gleichzeitig bietet es ideale Voraussetzungen für erneuerbare Energien: viel Sonne, stetigen Wind und weite Flächen. Die Kosten für Photovoltaik und Windkraft liegen deutlich unter europäischen Werten. Für Deutschland und die EU ist Namibia daher ein möglicher Partner, um künftig große Mengen an grünem Wasserstoff oder abgeleiteten Produkten wie Ammoniak und Methanol zu beziehen.
„Neben grünem Ammoniak und grünem Stahl umfasst Power-to-X auch die Herstellung nachhaltiger Alternativen zu petrochemischen Produkten wie E-Methanol oder E-Diesel“, erklärt Dr. Chokri Boumrifak, Mitautor einer der neuen Studien. Der Begriff Power-to-X (PtX) beschreibt die Umwandlung von Strom aus erneuerbaren Energien in chemische Energieträger, die transportiert und vielseitig eingesetzt werden können.
Wie alles begann
Namibia hat die Wasserstoffproduktion bewusst in seine Entwicklungsstrategie aufgenommen. Im März 2021 wurde sie im Harambee Prosperity Plan II als Motor für wirtschaftliche Diversifizierung verankert. Kurz darauf schrieb die Investitionsbehörde NIPDB im Rahmen der Southern Corridor Development Initiative Projekte aus.
Den Zuschlag erhielt im November 2021 das Joint Venture Hyphen Hydrogen Energy, das im Tsau ǁKhaeb Nationalpark eine Großanlage mit Wind- und Solarparks sowie Elektrolyse aufbauen will. Ziel: jährlich 300.000 Tonnen Wasserstoff, überwiegend weiterverarbeitet zu 1,7 Millionen Tonnen Ammoniak.
Parallel sicherte die Regierung politische und finanzielle Rahmenbedingungen – mit internationalen Partnerschaften (Deutschland, EU), einer eigenen Wasserstoffstrategie, dem Green Hydrogen Council und Beteiligungen über den Welwitschia Sovereign Fund sowie den Finanzierungsfonds SDG Namibia One.
Was produziert werden könnte
Namibia könnte künftig deutlich mehr herstellen als nur reinen Wasserstoff. Besonders attraktiv ist Ammoniak, ein Vorprodukt für Düngemittel und Sprengstoffe, das im Bergbau und in der Landwirtschaft gebraucht wird. Diesel wiederum spielt eine zentrale Rolle im Transport, in der Fischerei und im Bergbau.
Dr. Robin Ruff betont: „Diesel ist ein weit verbreiteter Energieträger im Transport, Bergbau, in der Landwirtschaft und der Fischerei.“ Hier zeigt sich: Namibia könnte nicht nur für den Export produzieren, sondern auch die eigene Wirtschaft versorgen.
Kurzfristig wären diese PtX-Produkte zwar teuer. Doch mit technologischem Fortschritt könnten die Preise sinken und auch namibische Industrien profitieren.
Wasser – der limitierende Faktor
So groß die Energieressourcen sind, so knapp ist das Wasser. Besonders die Region ||Kharas im Süden des Landes, wo Orte wie Lüderitz und Aus im Fokus der Wasserstoffprojekte stehen, leidet unter chronischem Wassermangel. Grundwasserreserven sind begrenzt und durch Übernutzung gefährdet. Alte Leitungsnetze verlieren große Mengen. Viele Dörfer sind nur unregelmäßig versorgt.
Gleichzeitig wächst die Nachfrage: Bevölkerung, Industrie und die geplante Wasserstoffproduktion brauchen mehr Wasser. Klimawandel und sinkende Niederschläge verschärfen das Problem.
Studien schlagen deshalb einen modularen Ansatz vor: Schrittweise Investitionen in die Infrastruktur, angepasst an die wachsende Nachfrage. So könnten kurzfristige Bedarfe gedeckt werden, ohne das System zu überlasten. Meerwasserentsalzung gilt als unvermeidbar. Doch sie ist energieintensiv und muss mit erneuerbaren Energien betrieben werden, um die Klimabilanz nicht zu gefährden.
Die unterschätzte Ressource Sole
Wo Entsalzungsanlagen arbeiten, fällt Sole an – hochkonzentriertes Salzwasser, das bisher meist ins Meer zurückgeleitet wird. Forschende sehen darin jedoch einen Rohstoffpool. „Mögliche Marktchancen liegen in Natriumchlorid, Soda, Natriumhydrogencarbonat sowie langfristig in der Rückgewinnung von Magnesium und Lithium“, heißt es in einer der Analysen.
Aus der Nebenströmung könnte so eine „Sole-Ökonomie“ entstehen. Lithium etwa ist ein Schlüsselrohstoff für Batterien. Würde Namibia diese Materialien zurückgewinnen, ließe sich die Wertschöpfung vor Ort erhöhen. Allerdings stehen Pilotprojekte noch am Anfang, die Verfahren sind teuer und technisch anspruchsvoll.
Logistik und Export – ohne Häfen geht nichts
Für den Export muss Namibia seine Infrastruktur massiv ausbauen. Haupthäfen sind Walvis Bay und Lüderitz. Von dort aus ließen sich Ammoniak oder synthetische Kraftstoffe verschiffen – beides einfacher als reiner Wasserstoff, der nur unter extremem Druck oder in verflüssigter Form transportiert werden kann.
Doch die Häfen brauchen neue Terminals, Pipelines, Speicher und Netze. All das erfordert Milliardeninvestitionen. Ohne ausländische Partner wird es kaum gehen.
Arbeitsplätze und Wertschöpfung
Die Regierung in Windhoek verbindet mit dem Wasserstoffboom große Hoffnungen. Bau, Betrieb und Wartung von Anlagen könnten tausende Jobs schaffen. Auch Zulieferer*innen und Dienstleistende vor Ort könnten profitieren.
Allerdings warnen Fachleute vor einer einseitigen Exportstrategie. Wenn internationale Konzerne dominieren, bleibt die Wertschöpfung möglicherweise nicht im Land. Entscheidend wird sein, ob Namibia eine eigene Industrie aufbauen kann – zum Beispiel Stahlwerke oder Düngemittelproduktion, die grünen Wasserstoff direkt nutzt.
Internationale Partner – Chance und Risiko
Deutschland ist bereits mit Projekten präsent. Entwicklungsbanken und EU-Programme prüfen Investitionen. Das ist Chance und Risiko zugleich. Einerseits könnten Gelder, Know-how und Märkte gesichert werden. Andererseits wächst die Gefahr, dass Namibia in eine Abhängigkeit von ausländischen Investoren gerät.
Die Studien fordern deshalb klare nationale Strategien. Nur so kann das Land selbst bestimmen, welche Projekte Vorrang haben und wie die Gewinne verteilt werden.
Umwelt und Gesellschaft im Blick behalten
Neue Industrieanlagen bedeuten auch Belastungen. Entsalzungsanlagen verändern Küstenökosysteme, große Solar- und Windparks beanspruchen Flächen. Wenn Arbeitskräfte in die Regionen ziehen, wächst der Druck auf Städte und Infrastruktur.
Die Studien empfehlen daher eine frühzeitige Beteiligung der Bevölkerung. Transparenz soll verhindern, dass Projekte an Protesten scheitern. Nachhaltige Landnutzung und Schutz der Artenvielfalt müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
Zahlen und Szenarien
Analysen zeigen, dass Namibia langfristig mehrere Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr herstellen könnte. Die Kosten könnten bis 2030 soweit sinken, dass die Produktion international wettbewerbsfähig wird – insbesondere im Vergleich zu fossilen Alternativen. Erste Pilotprojekte laufen bereits, darunter Anlagen in der Nähe von Lüderitz.
Die Vision: Namibia deckt nicht nur den eigenen Energiebedarf, sondern liefert große Mengen an klimaneutralen Energieträgern nach Europa und darüber hinaus.
Was jetzt nötig ist
Die Weichen müssen jetzt gestellt werden. Die Berichte empfehlen:
- Entwicklung einer klaren Wasserstoffstrategie.
- Ausbau von Entsalzungs- und Abwasserrecyclinganlagen.
- Modernisierung von Netzen, um Wasserverluste zu reduzieren.
- Investitionen in Häfen, Terminals und Speicher.
- Institutionelle Reformen, die Verantwortlichkeiten klarer regeln.
- Internationale Kooperationen – aber auf Augenhöhe.
Ein Beitrag von: