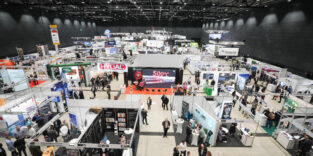Weniger Kohle, mehr Konflikte: Spagat in Deutschlands CO2-Bilanz
Deutschland verzeichnet einen signifikanten Rückgang der energiebedingten CO2-Emissionen: Eine Entwicklung, die vor allem der Transformation der Strom- und Wärmeerzeugung zu verdanken ist. Zwischen 2010 und 2023 sanken die gesamten energiebedingten Emissionen von privaten Haushalten und Wirtschaft um fast 30 Prozent. Hinter diesem Erfolg steht maßgeblich der Rückzug aus der Kohleverstromung.

Das Statistische Bundesamt hat die Verursacher von CO2-Emissionen genauer angeschaut und jetzt die Ergebnisse veröffentlicht.
Foto: Smarterpix/mc_stockphoto.hotmail.com
Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Verursacher von CO2-Emissionen unter die Lupe genommen und nach Bereichen aufgeschlüsselt. Die Energieversorgung als Teilsektor konnte ihre Emissionen um über 40 % reduzieren. Im Jahr 2023 stammten rund 38 % aller CO2-Emissionen aus diesem Bereich – eine immer noch hohe Zahl, jedoch deutlich reduziert im Vergleich zu früheren Jahren.
Dieser Fortschritt zeigt: In Bereichen, in denen zentrale Infrastrukturen erneuert und gesteuert werden können – etwa Kraftwerke oder zentrale Wärmeerzeugung – lassen sich systematische Emissionssenkungen durch gezielte Maßnahmen realisieren. Doch dieser technische Fortschritt bleibt sektorenübergreifend nicht folgenlos, denn die andere Hälfte der CO2-Bilanz erzählt eine andere Geschichte. Während Kraftwerksbetreiber ihre Anlagen umstellen und Versorger in große Speicherprojekte investieren, bleibt der Wandel im Verkehr, bei privaten Heizsystemen und im gewerblichen Alltag weitgehend aus. Hier offenbart sich eine strukturelle Trägheit, die weder mit Innovationsverweigerung noch mit Unkenntnis zu tun hat – sondern mit tief verankerten Mustern des Energieverbrauchs, verteilten Zuständigkeiten und komplexen Förder- und Gesetzeslagen.
Im Verkehrssektor zeigen sich diese Muster besonders deutlich. Seit dem coronabedingten Sondereffekt im Jahr 2020, als Mobilitätsverhalten abrupt zurückging, stagnieren die CO2-Emissionen auf demselben Niveau. Die Emissionen des Straßenverkehrs bewegen sich seitdem um die 155 Mio. t/a. Mehr als die Hälfte davon geht auf private Haushalte zurück – insbesondere auf Pkw-Nutzung im Alltag. Technologische Fortschritte im Fahrzeugbereich, wie Hybrid- und Elektroantriebe oder verbrauchsärmere Motoren, können diesen Effekt bislang nicht kompensieren. Denn das Verkehrsaufkommen bleibt hoch, die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge steigt, und die infrastrukturellen Voraussetzungen für alternative Mobilität – etwa durch Schienennetzausbau, ÖPNV-Ausweitung oder Ladeinfrastruktur – wachsen nicht im gleichen Maß.
Auffällig ist zudem, dass die politischen Anstrengungen im Verkehrsbereich vielfach auf langfristige Wirkungen ausgelegt sind, während kurzfristige CO2-Entlastungen ausbleiben. Emissionsarme Antriebstechniken kommen vor allem in Flotten, Carsharing-Angeboten und im urbanen Raum voran, während der ländliche Raum weitgehend auf konventionelle Mobilität angewiesen bleibt. Dieses Ungleichgewicht spiegelt sich nicht nur in Emissionsdaten, sondern auch in den gesellschaftlichen Debatten über Verbote, Anreize und Steuerpolitik wider. Gleichzeitig zeigt sich: Ohne massive Änderungen im Mobilitätsverhalten und ohne substanzielle Neuorientierung im Verkehrssystem sind die Klimaziele nicht erreichbar – ganz gleich, wie stark der Strommix dekarbonisiert wird.
Die Energieversorgung transformiert sich
Die Entwicklung im Bereich der Energieversorgung hingegen verläuft deutlich erfolgreicher. Der Anteil der Emissionen aus Kohleverbrennung sank von 2010 bis 2023 um mehr als die Hälfte (– 52,0 %). Der Rückgang der Kohleverstromung ist dabei ein zentrales Element dieser Bilanz. In der Energiewirtschaft können Technologien gezielt durch andere ersetzt werden – Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung, Wind- und Solarparks, sowie umfangreiche Batteriespeicher und Power-to-X-Anlagen schaffen neue Strukturen. Gesetzliche Vorgaben, CO2-Bepreisung und Investitionsprogramme schaffen hier klare Rahmenbedingungen. Die Treiber des Rückgangs sind gut identifizierbar: der gesetzlich verankerte Kohleausstieg, die gestiegene Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien, Effizienzsteigerungen bei Anlagen sowie ein insgesamt rückläufiger Energieverbrauch in bestimmten Industriebranchen. Dennoch bleibt die Energieversorgung der mit Abstand größte Emittent – wenn auch auf rückläufigem Kurs. Dieser Sektor illustriert, dass tiefgreifende Veränderungen möglich sind, wenn technische, gesetzliche und wirtschaftliche Strukturen zusammenspielen.
CO2-Emissionen – der Alltag bleibt häufig fossil
Dem gegenüber stehen die privaten Haushalte, die trotz eines Rückgangs um knapp ein Viertel seit 2010 weiterhin erheblich zur CO2-Bilanz beitragen. Die wichtigsten Emissionsquellen in diesem Bereich sind Heizen und Warmwasserbereitung. Zwar sank der Einsatz von Heizöl deutlich, auch bei Erdgas zeigen sich moderate Rückgänge, dennoch bleibt der Wärmesektor in den Haushalten stark fossil geprägt. Der Umstieg auf Wärmepumpen, Solarthermie oder Fernwärme geht bislang eher schleppend voran – nicht zuletzt wegen hoher Investitionskosten, mangelnder Handwerkerkapazitäten und teils unklarer Förderbedingungen. Gerade in älteren Gebäudebeständen, die nicht oder nur mit großem Aufwand energetisch saniert werden können, bleiben fossile Heizsysteme im Einsatz. Auch das verarbeitende Gewerbe leistet bislang nur begrenzte Beiträge zur Emissionsminderung. Hier sanken die energiebedingten CO2-Emissionen um rund 12 % seit 2010 – ein Rückgang, der weniger durch tiefgreifende Umstellungen als durch Effizienzgewinne, Prozessoptimierungen und begrenzte Substitution fossiler Energieträger zustande kam. Emissionen aus Mineralölprodukten und Erdgas konnten reduziert werden, aber abgeleitete Gase aus industriellen Prozessen blieben nahezu konstant oder stiegen sogar leicht. Insgesamt bleibt die Industrie damit eine zentrale Herausforderung – gerade auch im Hinblick auf die Transformation energieintensiver Prozesse in Chemie, Stahl oder Zementproduktion.
Die sektorale Bilanz legt damit ein Spannungsfeld offen: Während zentrale, staatlich regulierte oder industriegetriebene Sektoren strukturell verändert werden können, bleiben verhaltensnahe, kleinteilige und dezentral organisierte Emissionsquellen auf hohem Niveau. Das betrifft insbesondere die private Mobilität, die Wärmeversorgung in Bestandsgebäuden und kleinteilige gewerbliche Prozesse.
Lesen Sie auch: Photovoltaik nachhaltiger gestalten