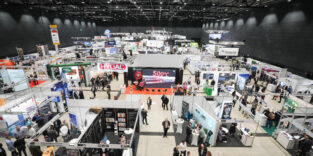Mit dem GridMaximizer E-Autos im Schwarm laden
Die steigende Verbreitung von E-Autos stellt Verteilnetze vor große Herausforderungen. In einem neuen Forschungsprojekt entwickelt die TH Köln eine intelligente Steuerungssoftware, die Ladestationen in Wohnvierteln vernetzt und netzdienlich priorisiert lädt – ohne aufwendigen Netzausbau oder zentrale Kontrolle.

Der Versuchsstand umfasste elektrotechnische Komponenten wie Wechselrichter, Batterien sowie Mess- und Steuereinheiten. Drei der simulierten Haushalte waren mit einer Wallbox ausgestattet.
Foto: Henrike Klehr/TH Köln
Moderne Stromverteilnetze, vor allem in Wohngebieten, wurden ursprünglich nicht für hohe elektrische Lasten durch gleichzeitiges Laden zahlreicher E-Fahrzeuge konzipiert. Mit zunehmender Marktdurchdringung von E-Autos entsteht jedoch genau dieses Szenario: Mehrere Fahrzeuge werden in den Abendstunden gleichzeitig an die heimische Wallbox angeschlossen, wenn die Haushaltslasten ohnehin bereits hoch sind. Das kann zu Spannungseinbrüchen oder Überlastungen im lokalen Netz führen – ein Problem, das bislang meist durch kostspieligen Netzausbau oder aufwendige Lastmanagementsysteme adressiert wird.
Ein Forschungsteam am Cologne Institute for Renewable Energy (CIRE) der Technischen Hochschule Köln verfolgt nun einen anderen Weg. Im Rahmen des Projekts „GridMaximizer“ wurde ein dezentrales Steuerungskonzept für das netzdienliche Laden von E-Fahrzeugen entwickelt. Ziel ist es, die Ladeleistung mehrerer Fahrzeuge in einer Nachbarschaft so zu koordinieren, dass die Stabilität des Netzes gewahrt bleibt – ohne Eingriffe durch den Netzbetreiber und ohne zusätzliche Hardware in der Infrastruktur. Die Steuerung erfolgt rein softwarebasiert und berücksichtigt sowohl die physikalischen Grenzen des Stromnetzes als auch die individuellen Anforderungen der Nutzenden.
Intelligente Algorithmen in der Ladeinfrastruktur und Schwarmverhalten
Kern des Konzepts ist ein intelligenter Algorithmus, der aktuelle Netzparameter wie Spannung und Stromstärke sowie typische Verbrauchsmuster im Haushalt auswertet. Im Laborversuch der TH Köln wurden sechs Haushalte simuliert, von denen drei mit Wallboxen für das Laden von E-Fahrzeugen ausgestattet waren. Die übrigen Haushalte dienten zur Abbildung realistischer Hintergrundlasten. Über ein mehrere hundert Meter langes Versuchsnetz mit realen Leitungen und Messsystemen wurde ein typisches Niederspannungsnetz abgebildet. Ziel war es, die Wechselwirkungen zwischen Haushaltslast und Ladevorgängen detailliert zu analysieren.
Der entwickelte Algorithmus greift auf kontinuierlich erfasste Messdaten zu und berechnet daraus in Echtzeit, welche Ladeleistung das Netz unter den gegebenen Bedingungen bereitstellen kann, ohne dass Spannungsgrenzen überschritten werden. Dabei wird keine zentrale Steuerungseinheit benötigt – jede Wallbox trifft eigenständig Entscheidungen basierend auf lokal verfügbaren Informationen. So entsteht ein sogenanntes „Schwarmverhalten“: Die Ladepunkte kommunizieren zwar nicht direkt miteinander, verhalten sich jedoch im Kollektiv koordiniert, da sie auf dieselben netzseitigen Einflussgrößen reagieren.
E-Auto-Nutzende können mitbestimmen
Eine Besonderheit des Konzepts ist die Möglichkeit zur individuellen Zielvorgabe: Anwenderinnen und Anwender können über eine einfache Benutzeroberfläche mitteilen, bis wann ihr Fahrzeug mit welchem Ladezustand bereitstehen soll. Der Algorithmus plant daraufhin die Ladezeiten so, dass diese Wünsche erfüllt werden, ohne die Netzstabilität zu gefährden. Werden mehrere Fahrzeuge gleichzeitig angeschlossen, priorisiert das System anhand von Flexibilitäten – etwa ob ein Fahrzeug sofort oder erst in mehreren Stunden vollgeladen sein muss.
In den Versuchen zeigte sich, dass das Konzept auch bei hoher Auslastung des Netzes zuverlässig funktionierte. Die Spannungsgrenzen im Testnetz wurden zu keinem Zeitpunkt verletzt, und alle Fahrzeuge wurden entsprechend den Nutzendenangaben geladen. Durch die dezentrale Umsetzung entfällt zudem der Aufwand für eine zentrale Steuerarchitektur, was potenzielle Einstiegshürden bei einer künftigen Umsetzung senkt.
Vom Labor in die Praxis, ohne zusätzliche Leitungsnetze
Das GridMaximizer-Projekt wurde über 18 Monate hinweg mit knapp 800 000 € durch das Land Nordrhein-Westfalen und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Bereits in der frühen Konzeptionsphase war das Projekt auf Skalierbarkeit ausgelegt. Perspektivisch ist vorgesehen, auch andere steuerbare Verbraucher – etwa Wärmepumpen oder stationäre Batteriespeicher – in das System zu integrieren. Damit könnte eine umfassende netzdienliche Betriebsführung für ganze Quartiere ermöglicht werden.
Ein weiterer Schritt ist die Umsetzung in einem Feldversuch. Die TH Köln bereitet derzeit gemeinsam mit einem regionalen Netzbetreiber ein erstes Praxisprojekt vor. Ziel ist es, das System unter realen Bedingungen in einem echten Verteilnetz zu testen. Dabei stehen nicht nur technische Fragen im Vordergrund sondern auch regulatorische und wirtschaftliche Aspekte sollen betrachtet werden. So ist zum Beispiel noch unklar, wie eine netzdienliche Steuerung vergütet oder vertraglich geregelt werden kann, wenn kein direkter Eingriff durch den Netzbetreiber erfolgt.
Laden von E-Autos netzverträglich gestalten
Neben dem technischen Fokus hat das Projekt auch eine patentrechtliche Dimension. Für den entwickelten Steuerungsalgorithmus wurde eine Patentanmeldung in den USA bereits eingereicht, das europäische Patentverfahren läuft noch. Die TH Köln sieht darin eine wichtige Grundlage für mögliche Lizenzierungen oder Kooperationen mit Industriepartnern. Denn das Konzept bietet aus Sicht der Forschenden einen gangbaren Weg, das Laden von E-Autos netzverträglich zu gestalten – auch dort, wo der klassische Netzausbau an Grenzen stößt.
Das Projekt setzt damit an einem zentralen Engpass der Energiewende an: der Kopplung von Mobilität und Stromversorgung auf lokaler Ebene. Gerade in Bestandsquartieren, in denen Infrastrukturmaßnahmen schwer umsetzbar oder gesellschaftlich wenig akzeptiert sind, könnten softwarebasierte Steuerungslösungen wie der GridMaximizer eine wichtige Rolle spielen. Die Forschungsarbeiten zeigen, dass das auch auch ohne flächendeckende Digitalisierung oder neue Leitungsnetze machbar wäre. Ob das Konzept in der Praxis überzeugt, wird sich im kommenden Jahr zeigen. Die Projektpartner sehen in der Kombination aus Nutzerorientierung, technischer Robustheit und Verzicht auf zentrale Steuerung ein Alleinstellungsmerkmal.